Meldungen über das Dritte Reich
Stalin erwartete 1942 einen weiteren Angriff auf Moskau -- Selbstmord im Dritten Reich zur letzten Wahrung der Würde - der Leidensweg der deutschen Wolfskinder aus Ostpreussen in Litauen -- alliierte Holzbomben gegen NS-Attrappen -- unangenehme Wahrheiten über die Ostfront -- der Kunstzensor Ziegler, der "entartete Kunst" definierte -- die Autobahn-Legende -- Kampf um einen alliierten Piloten auf einer dänischen Insel 1943 -- Hitler verbot bei Länderspielen Niederlagen -- der "Brieftaubencode" ist immer noch nicht geknackt -- Kriegsschuld-Diskussion Roosevlet (Rosenfelt) gegen Goebbels 1943 -- NS-Anatomie im Dritten Reich an erschossenen Sträflingen -- ein Pfarrer gestand in den 1960er Jahren seine Judenmorde und durfte weiterarbeiten -- Erziehung in der "Napola" -- das "Reichskonkordat" mit dem Vatikan gilt bis heute (2013)
11.5.2012: Stalin erwartete 1942 einen weiteren Angriff auf Moskau
aus: Welt online: "Fall Blau" 1942: Der zweite Blitzkrieg, der Stalin vernichten sollte; 11.5.2012;
http://www.welt.de/kultur/history/article106284507/Der-zweite-Blitzkrieg-der-Stalin-vernichten-sollte.html
<Mit der Operation "Fall Blau" wollte Hitler Stalingrad und die Ölquellen im Süden erobern. Der Plan war derart riskant, dass Stalin ihn nicht erwartete. Er glaubte an die Offensive gegen Moskau.
Von Sven Felix Kellerhoff
Jede moderne Armee hat dieselbe Achillesferse: Treibstoff. Ohne Benzin fährt kein Panzer, fliegt kein Flugzeug, kann kein Generator Strom für Funkgeräte oder U-Boot-Batterien erzeugen. Hitlers Drittes Reich aber hatte sich ohne nennenswerte Ölvorräte in den Krieg gestürzt. 1939 mussten zwei Drittel des deutschen Erdölverbrauchs importiert werden. Nur weil im Hitler-Stalin-Pakt von 1939 die UdSSR umfangreiche Öllieferungen zugesagt hatte, konnte die Wehrmacht überhaupt ihre Blitzkriege führen. Drei Viertel des sowjetischen Erdölexports ging 1940 nach Deutschland, rund 617.000 Tonnen.
Doch damit war es, trotz weiterhin bestehender Unterversorgung der deutschen Armee, mit dem Angriff auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 vorbei. Hitlers Ziel war es, Stalin bis zum Herbst zu unterwerfen, die Sowjetunion zu kolonisieren und so Zugriff auf die Rohstofflager zu bekommen. Doch im Dezember 1941 scheiterte dieses Vorhaben endgültig.
Aus diesem Dilemma gab es für die Wehrmacht nur zwei mögliche Auswege: Einerseits die Eigenproduktion an Kraftstoff erhöhen, andererseits mit Vorrang die sowjetischen Ölfelder erobern. Mit enormem Aufwand wurde deshalb die Erzeugung synthetischen Benzins vorangetrieben, durch Verflüssigung der in Deutschland reichlich vorhandenen Kohle. Sieben Hydrierwerke waren 1939 in Betrieb, bis 1941 kamen vier weitere hinzu. Trotz deutlich steigender Produktionskapazitäten brauchte die deutsche Kriegswirtschaft aber vor allem kurz- und mittelfristig zusätzliche natürliche Ölquellen, über die des verbündeten Rumäniens hinaus.
Schon 1918 standen Deutsche in Baku
Vor einem ähnlichen Dilemma hatte schon im Ersten Weltkrieg die Oberste Heeresleitung gestanden – obwohl die Schlachten 1914 bis 1918 noch viel weniger motorisiert und daher treibstoffabhängig geführt wurden. Der damalige Generalquartiermeister Erich Ludendorff schickte im Frühjahr 1918 erst einige tausend, schließlich 19.000 Soldaten als deutsche Besatzung auf die russischen Erdölfelder bei Tiflis im Kaukasus. Sie sollten einerseits gefürchtete britische Angriffe abwehren, andererseits die Quellen für die deutschen Kriegswirtschaft sichern.
Der deutsche Generalstab im nächsten Krieg hatte wohl diese Operation vor Augen, als General Georg Thomas, der Chef des Wehrwirtschafts- und Rüstungsamtes, 1941 vor einem bevorstehenden "Ölloch" warnte. Hitler selbst hatte in seiner konkreten Ankündigung eines Angriffs auf die Sowjetunion am 31. Juli 1940 die Rohstofffrage nur gestreift.
Ein gutes Jahr später jedoch, am 12. August 1941, vertrat er bereits die Auffassung, dass "die Vernichtung beziehungsweise Wegnahme lebenswichtiger Rohstoffquellen noch entscheidender ist als die Besetzung oder Zerstörung industrieller Verarbeitungszentren". Auch Marine und Luftwaffe, die zu hundert Prozent auf Treibstoffversorgung angewiesen waren, drängten im November 1941, wenigstens das nordwestlichste der großen kaukasischen Erdölvorkommen so schnell wie möglich zu erobern.
Harte Verluste des Winters
Es war daher ganz konsequent, dass sich zum Jahreswechsel 1941/42 der Blick Hitlers ebenso wie jener des Generalstabes auf den Süden der Sowjetunion richtete. Eine erste Andeutung des Kriegsplanes für das neue Jahr machte der "Führer" am 3. Januar 1942 gegenüber dem japanischen Botschafter in Berlin, Hiroshi Oshima.
In den kommenden Monaten entwickelten die zuständigen Stäbe konkrete Vorhaben und richteten die Umstrukturierung des Ostheeres nach den verheerenden Verlusten des harten Winters entsprechend aus. Das Ergebnis war der "Fall Blau", die große Offensive der Wehrmacht im Süden der Sowjetunion ab Frühsommer 1942, die nun den Sieg über Stalin bringen sollte.
Militärische Fachleute jedoch hatten Zweifel. Der Chef des Ersatzheeres, Generaloberst Friedrich Fromm, spielte zu dieser Zeit schon mit Gedanken an einen Friedensschluss mit der Sowjetunion; der Generalquartiermeister Eduard Wagner sprach intern von "utopischen Offensivplänen"; General Thomas warnte, dass das "Missverhältnis zwischen Kriegsbedarf und Deckungsmöglichkeiten immer größer" werde und riet, die "militärischen Operationen im Sommer 1942 an die Treibstofflage anzupassen". Doch diese hellsichtigen Voraussagen blieben ungehört.
Ein Drittel der Einsatzstärke verloren
Im Frühjahr 1942 hatte die Wehrmacht an der Ostfront rund 35 Prozent ihrer Einsatzstärke von Juni 1941 verloren. Der Kampfkraftverlust war sogar noch höher; er lag bei 50 Prozent für die Heeresgruppe Süd und sogar 65 Prozent für die beiden anderen Heeresgruppen Mitte und Nord. 3319 abgeschossenen Panzern standen nur 732 neu ausgelieferte Kettenfahrzeuge gegenüber. Insgesamt beurteilte der Generalstab mit Stichtag 30. März 1942 nur acht der insgesamt 162 Divisionen des Ostheeres als "für alle Aufgaben geeignet", also "voll verwendungsfähig". Ein Jahr zuvor hatte diese Bewertung noch für 136 der damals 209 Divisionen gegolten.
All das wurde jedoch ignorierte Hitler jedoch beim Entwurf seines "Siegplanes". Weitere schwere strategische Fehler kamen hinzu: Die Operation hatte nicht ein, sondern zwei Hauptziele – nämlich neben der Eroberung der kaukasischen Ölfelder auch die Zerschlagung der sowjetischen Rüstungskapazität im Süden, vor allem um und in Stalingrad. Selbst bei optimalem Verlauf des Feldzuges musste am nördlichen Rand des deutschen Vormarsches entlang des Flusses Don eine auf mehr als das doppelte gestreckte Frontlinie entstehen.
Das bot für den Gegner beste Möglichkeiten, mit einem Gegenschlag die vorrückenden Truppen von der Versorgung abzuschneiden und einzukesseln. Schließlich mussten sich die Angriffsspitzen zum einen Hauptziel der Operation, Stalingrad, gut 500 Kilometer durch Feindesland kämpften, zum anderen Ziel, Baku am kaspischen Meer, aber sogar etwa 1200 Kilometer. Das war bis zum Einbruch des folgenden Winters voraussichtlich im November 1942 erkennbar kaum zu schaffen.
Stalin erwartete den Angriff auf Moskau
Nicht zuletzt deshalb erwartete der Generalstab der Roten Armee im Frühjahr 1942 eine deutsche Offensive in andere Richtungen. Die bevorzugte Versorgung der Heeresgruppe Süd mit Nachschub wurde zwar registriert, doch als mögliches Täuschungsmanöver angesehen. Den deutschen Hauptstoß erwarteten die Generäle Alexander Wassilewski und Georgi Schukow vom südlichen Abschnitt der deutschen Heeresgruppe Mitte nach Moskau, eventuell auch weiter nach Osten ausgreifend zur Stadt Gorki, um den Großraum Moskau einzukesseln.
Richtung Süden erwarteten dagegen Stalins fähigste Militärs höchstens Entlastungs- und Ablenkungsangriffe. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass die strategisch so versierten deutschen Generalstabsoffiziere eine so gefährliche Operation wie den "Fall Blau" planen könnten. Als die Offensive am 28. Juni 1942 begann, erkannten Wassilewski und Schukow bald ihre Chance, der Wehrmacht eine verheerende Niederlage beizubringen: die Schlacht um Stalingrad.>
========
25.6.2012: Selbstmord im Dritten Reich zur letzten Wahrung der Würde
aus: n-tv online: Zwischen Verzweiflung und SelbstbehauptungSelbstmord im Dritten Reich; 25.6.2012;
http://www.n-tv.de/leute/buecher/Selbstmord-im-Dritten-Reich-article6075516.html
Buchempfehlung: Christian Goeschel: Selbstmord im Dritten Reich. Suhrkamp, 21,90 Euro. Online-Bestellung hier.<Von Solveig Bach
Arbeitslosigkeit und Entwurzelung, Geisteskrankheit und Liebeskummer, Verblendung und Widerstand - die Gründe, sich selbst zu töten, sind im Dritten Reich vielfältig. Unter der Herrschaft der Nazis steigen die Zahlen, nicht zuletzt deshalb, weil der Freitod vielen als letzte Möglichkeit bleibt, ihre Selbstbestimmung und Würde zu wahren.In den Augen der Nationalsozialisten war ein Selbstmord ein feiger Akt, der persönliche Schwäche offenbarte. Mehr noch, die Selbsttötung war völlig überflüssig, weil ja der "Aufbau einer Volksgemeinschaft" den Deutschen wieder ein "schönes" Leben bescherte. An den Selbstmordzahlen im Dritten Reich änderte das nichts. Mehr noch: In seinem Buch "Selbstmord im Dritten Reich" vertritt Christian Goeschel die These, dass Selbstmord seit der Weimarer Republik eine irritierend häufige Todesart war, und geht den verschiedenen Gründen nach.
Nach dem Ersten Weltkrieg begründeten viele Kriegsheimkehrer ihren Freitod mit der Schmach der Niederlage. So wurde die Selbsttötung zu einer heroischen Tat, ausgelöst vom Versailler Vertrag und der galoppierenden Inflation. Hinzu kamen auch noch die allgemeine Unsicherheit, das Gefühl politischer Unordnung und wachsende soziale und wirtschaftliche Not.
Die Lokalzeitungen jener Jahre waren voll mit Berichten über arbeitslose Familienväter, die sich unfähig fühlten, ihrer Rolle als Versorger gerecht zu werden. Die Suizide wurden schließlich zum Thema politischer Auseinandersetzung, in der die verschiedenen politischen Lager versuchten, den Lebensüberdruss in einen gesellschaftlichen Kontext stellen, um bestimmte Wahlentscheidungen zu provozieren.
Ausweg aus brutaler Verfolgung
Mit der Machtübernahme der Nazis traten die wirtschaftlichen Gründe zunächst in den Hintergrund. Allerdings konnten die Nazis ihre Propaganda aus den Jahren der Weimarer Republik, sie würden Hunger und Not besiegen, nicht endgültig einlösen. Es kamen neue Motive hinzu, sich selbst zu töten; die Zahlen sanken nicht.
Verschiedene Bevölkerungsgruppen gerieten in die Verfolgungsmaschinerie der Nationalsozialisten: Sozialdemokraten, Kommunisten, Kranke, Homosexuelle, Liberale, Kommunisten, Juden. Menschen töteten sich aus Angst vor dem Terror, manche taten es in Gefängnissen, SS-Verließen oder im KZ, Folter und die eigene Ermordung vor Augen. Goeschel sieht in diesen Selbstmorden Akte der Selbstbehauptung, die letzte Möglichkeit, sich der allumfassenden Macht eines autoritären Regimes zu entziehen.
Der Historiker Goeschel beschreibt regelrechte Selbstmord-Wellen unter jüdischen Bürgern, immer dann, wenn sich die Repressionen verstärkten oder schließlich, wenn Deportationen bevorstanden. "Wie es in uns deutschen Juden aussieht, - mögt ihr aus meinem Schritt ersehen!", schrieb beispielsweise der jüdische Geschäftsmann Fritz Rosenfelder in seinem Abschiedsbrief. Diese Selbstmorde waren den Nazis nur recht und wurden von ihnen zum Teil noch propagandistisch augeschlachtet.
Weltuntergangsstimmung
Als das "Dritte Reich" im Frühjahr 1945 zusammenbrach, konnten die Nazis auch ihr Selbstmordtabu nicht länger aufrechterhalten. Vielen führenden Nationalsozialisten war die Aussichtslosigkeit ihrer Lage wohl bewusst. Nicht nur Hitler, Goebbels und Himmler töteten sich selbst, als sich die Alliierten Berlin immer weiter annäherten. Auch andere hochrangige Nazis begingen Selbstmord - ob aus Sorge, zur Rechenschaft gezogen zu werden oder aus Unrechtsbewusstsein, bleibt allerdings offen.
Verzweifelte Soldaten suchen an der Front den Freitod, ohne dass das so genannt wurde. Viele Zivilisten fürchteten den Einzug der Russen und gingen freiwillig in den Tod.
Goeschel hat für seine zunächst auf Englisch erschienene und nun ins Deutsche übertragene Studie nicht nur Selbstmordstatistiken, Polizei- und Zeitungsberichte sowie NS-Dokumente ausgewertet. Er dokumentiert, wann immer er das Material zur Verfügung hat, auch Abschiedsbriefe und Tagebuchnotizen von Selbstmördern. Goeschel macht keinen Unterschied, ob ein einfacher Arbeiter und Angestellter, ein Beamter, Soldat, Jude oder Sozialist oder ein hoher Funktionsträger des NS-Regimes sein Leben selbst beendet. Schon in der Einleitung macht er deutlich, dass ein Freitod immer persönliche wie gesellschaftliche Anteile hat. Beide Seiten beleuchtet er und macht die Menschen hinter den oft fragwürdigen Statistiken sichtbar.
Quelle: n-tv.de>
========
25.6.2012: <Ostpreußen 1945: Der Leidensweg der deutschen Wolfskinder in Litauen>
aus: Welt online; 25.6.2012;
http://www.welt.de/kultur/history/article106630329/Der-Leidensweg-der-deutschen-Wolfskinder-in-Litauen.html
Buchempfehlung: Sonya Winterberg: "Wir sind die Wolfskinder. Verlassen in Ostpreußen". (Piper, München. 320 S., 19,99 Euro. ISBN 978-3-492-05515-4)<Auf rund 20.000 schätzt man die Zahl der Kinder, die bei Kriegsende ihre Familien verloren und irgendwie nach Litauen gelangten. Jetzt versammelt ein Buch ihre verdrängten, verstörenden Geschichten.
Als Alfreda Kazukauskiene Anfang der Neunzigerjahre in Vilnius vor dem Schaufenster eines Spielzeugladens steht, kommt ihr beim Anblick eines Holzspielzeugs plötzlich wieder ein deutsches Wort in den Sinn: Hampelmann. Seit Jahrzehnten war ihre Muttersprache verschüttet, verschlossen wie die Erinnerung an ihre ersten Lebensjahre, als sie noch Luise Quitsch hieß.
Jetzt plötzlich kommen sie wieder, die Bilder ihres Elternhauses in Ostpreußen, von Mutter, Vater und Geschwistern. Aber auch schlimme Erinnerungen an Bomben und Flucht, an ein russisches Kinderheim, an den nagenden Hunger, den Durst, das vergebliche Warten auf die Mutter.
Damals, 1945, endete ihre deutsche Geschichte und Identität. Das fünf Jahre alte Waisenkind fand litauische Adoptiveltern. Aus Luise wurde Alfreda. Ihre Muttersprache verlernte sie. Dass sie eine deutsche Vergangenheit hatte, war ihr jahrzehntelang nicht bewusst.
Manche sind Analphabeten
Alfreda Kazukauskiene ist ein "Wolfskind", eines jener ostpreußischen Kinder, die in den Kriegswirren und auf der Flucht vor der Roten Armee von ihren Familien getrennt wurden und später unter meist dramatischen Umständen Zuflucht in Litauen fanden. Von ihrem Schicksal erzählt jetzt das Buch "Wir sind die Wolfskinder. Verlassen in Ostpreußen" von Sonya Winterberg.
Es ist ein erschütterndes Dokument, das schon deshalb lesenswert ist, weil es die vielleicht letzten Zeitzeugenberichte enthält. Denn es leben heute nicht mehr viele Wolfskinder, die meisten sind vom Alter gezeichnet, manche schwer krank. Bald wird ihr Schicksal Geschichte sein.
Nachdem sie jahrzehntelang verdrängen und verschweigen mussten, ist es für die meisten ehemaligen Wolfskinder befreiend, jetzt offen über ihr schweres Leben sprechen zu können. Mit Alfreda Kazukauskiene ging das Schicksal noch gnädig um. Zwar verlor sie ihre Ursprungsfamilie, doch sie fand liebevolle Aufnahme in ihrer neuen Heimat. Ihre litauischen Adoptiveltern legten Wert auf Bildung. Alfreda machte Karriere in der Verwaltung. Doch damit ist sie die absolute Ausnahme.
Viele erlagen den Strapazen
Die meisten der noch lebenden Wolfskinder hatten nie die Möglichkeit einer ordentlichen Schulbildung, manche sind Analphabeten, Zeit ihres Lebens mussten sie schwere körperliche Arbeiten verrichten und beziehen heute kümmerliche Renten.
Etwa 20.000 Wolfskinder soll es am Ende des Zweiten Weltkriegs in Ostpreußen gegeben haben. Viele von ihnen mussten mit ihren eigenen Augen mit ansehen, wie ihre Eltern und Geschwister starben. Der Hunger trieb die Kinder gleich Wölfen durch die Wälder nach Litauen, wo es angeblich Brot und Kuchen im Überfluss gab. Die meisten Kinder, vor allem die Jüngeren, erlagen diesen Strapazen.
Fast alle mussten sie betteln, manche wurden wie Leibeigene auf den Höfen gehalten, Schläge und Vergewaltigung inbegriffen. "Was ich erlebt habe, was mir angetan wurde, ist zu viel für ein Menschenleben", sagt etwa die 73-jährige Christel Scheffler stellvertretend für viele.
Verweigerte deutsche Staatsbürgerschaft
Neben den erschütternden Lebensberichten enthält das Buch auch verstörende Passagen über die deutsche Politik. Sie hat sich gegenüber den Wolfskindern kleinlich und bürokratisch verstockt gezeigt. Nachdem Litauen 1990 unabhängig geworden war, nahmen die Wolfskinder die litauische Staatsbürgerschaft an. Die deutsche Staatsbürgerschaft wurde ihnen deshalb verweigert oder sie konnten sie nur über ein kompliziertes, langwieriges Einbürgerungsverfahren erlangen. Auch Rentenansprüche wurden abgewimmelt. Dagegen zahlt der litauische Staat ihnen als im Krieg Verschleppte heute eine kleine Rente.
Nach jahrzehntelangem Hürdenlauf gelang es manchem ehemaligen Wolfskind, doch noch nach Deutschland überzusiedeln. So wie Rudi Herzmann. Doch das Land seiner Träume wurde für ihn zum Albtraum: "In Deutschland habe ich mich mehr als Ausländer gefühlt, als jemals in Litauen." Nach 13 Jahren kehrte er in das Land zurück, das er erst jetzt als seine eigentliche Heimat erkannte.
dpa/bas>========
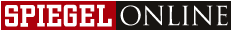
27.6.2012: Alliierte Holzbomben gegen NS-Attrappen: <Skurrile Weltkriegstaktik: Bomben aus dem Baumarkt>
aus: Spiegel online; 27.6.2012;
http://einestages.spiegel.de/s/tb/25081/briten-bombardieren-im-zweiten-weltkrieg-deutsche-holzflugzeuge-mit-holzbomben.html
Buchempfehlung: Pierre-Antoine Courouble: "Das Rätsel der Holzbomben". Verlag "Presses du Midi", Toulon 2010, 262 Seiten.
<Britischer Humor mit Knalleffekt: Alliierte Bomber sollen im Zweiten Weltkrieg Flugzeugimitate der Wehrmacht angegriffen haben - mit Munitionsattrappen aus Holz. Beweise gab es dafür nicht. Bis ein Hobbyforscher dem Rätsel um die sonderbare Taktik nachging.
Von Solveig Grothe
Es war eine dieser Geschichten aus dem Krieg, die Lucien Courouble seinem Sohn Pierre-Antoine erzählte, als sie im Sommer 1973 auf dem Weg zu ihrem neuen Haus in Templeuve am Flughafen von Lesquin vorbeikamen. Die Deutschen hätten dort im Krieg Holzflugzeuge aufgestellt, berichtete der Vater. Sie wollten die Alliierten glauben machen, dass sie noch immer große Mengen an Fluggeräten besäßen. Doch die Alliierten hätten den Trick durchschaut. Statt echte Munition zu vergeuden, warfen die Engländer Holzbomben über den Holzflugzeugen ab. "Wood for Wood" soll darauf gestanden haben.
Tage später, Ende Mai 1944, seien sie wieder auf dem Flugplatz gewesen, und es habe einen Luftangriff gegeben. Noch während sie sich in Bombenkratern versteckten, sei ihnen aufgefallen, dass keine Explosionen zu hören waren. Nachdem die britischen Flugzeuge fort waren und Entwarnung gegeben wurde, hätten sie auf dem Gelände verstreut herumliegende Holzbalken entdeckt, an einem Ende angespitzt. Sie seien mit Tarnfarbe bemalt gewesen und hätten eine weiße, gut sichtbare Aufschrift getragen: Wood for Wood. "Das war die Reaktion der Engländer auf unsere Generalstabskarten", schlussfolgerte André Maéro, einer der wenigen noch lebenden Augenzeugen.
Eine hübsche Anekdote. Dem Journalisten Pierre-Antoine Courouble fiel sie wieder ein, als er mehr als 30 Jahre später für ein Buch über die Geschichte des Flugplatzes in der Nähe von Lille in Nordfrankreich recherchierte. Er machte sich auf die Suche nach Zeugen der mysteriösen Holzbombenabwürfe - in der Umgebung von Lesquin, aber auch im Internet. Doch die Reaktionen auf seine Nachforschungen stimmten ihn nicht eben optimistisch.
Die Geschichte mit den Holzbomben sei totaler Quatsch, belehrten ihn Nutzer einschlägiger Militärforen. Warum hätten die Briten für eine solche Aktion ihre Flugzeuge und Besatzungen riskieren sollen? Warum hätten sie dem Gegner zeigen sollen, dass sie von den Attrappen wussten? Kein Tagesbefehl, keine Einsatzmeldung sei bekannt, in denen davon berichtet worden wäre. Auch technisch, so musste Courouble lesen, wäre es ganz unmöglich gewesen, mit so leichtem Material einen gezielten Abwurf zu tätigen. Geschichten dieser Art erzähle man sich an vielen Flugplätzen, so der Tenor. Es sei wohl eher eine weit verbreitete Legende.
Doch Courouble gab so schnell nicht auf. Denn er hatte auch einige positive Rückmeldungen erhalten - per E-Mail, von Personen, die sich nicht öffentlich in einem Forum äußern wollten.
Der Zeuge
Courouble lernte etwa André Maéro kennen. Der Franzose war als 18-Jähriger in Salon-de-Provence, im Süden des Landes, zusammen mit anderen jungen Männern von den deutschen Besatzern dienstverpflichtet worden, um den dortigen Flugplatz nach Bombenangriffen wiederherzurichten. Dabei hatte er beobachtet, wie einer seiner Kumpel heimlich Notizen machte. Der Freund verriet ihm, dass er auf englischen Generalstabskarten die echten und die falschen Flakstellungen der Deutschen markierte, um sie den Alliierten zu übergeben.
Was Courouble stutzig machte: In alten Zeitungsartikeln und Tagebuchnotizen von Kriegsreportern las er nicht nur von britischen Holzbomben. Englische Militärs hatten berichtet, dass auch die Deutschen bei ihrem Feldzug in Nordafrika Holzbomben abgeworfen hätten. Und auch an der russischen Front habe es ähnliche Fälle gegeben. Sollte es sich also um eine wechselseitige Aktion gehandelt haben? Courouble allerdings schien es unwahrscheinlich, dass die Deutschen während der Schlacht um England, des Feldzugs in Nordafrika oder der Belagerung von Leningrad so viel Freizeit gehabt haben könnten, um Holzbomben zu basteln.
Die Vermutung
Ein Foto brachte ihn zu einer anderen Erklärung: Es zeigte deutsche Waffenmeister beim Beladen eines Bombers vom Typ Heinkel 111 - mit Holzbomben. So sah es jedenfalls aus. Eine Analyse durch Experten allerdings ergab, dass es sich zumindest in diesem Fall um Übungsbomben handelte, mit einem Körper aus Beton und einem Steuerschwanz aus Blech. Sie waren mit Holz verkleidet, um daran Glasampullen zu befestigen, die beim Aufschlag Rauch entwickelten und dem Piloten den Einschlag anzeigten. So war es wohl zu erklären, dass man jenseits des Ärmelkanals auch dann von Holzbomben sprach, wenn die Deutschen eine Übungsbombe in die Scheinanlagen warfen.
Die Annahme, dass es sich um eine wechselseitige Aktion gehandelt haben könnte, verwarf Courouble damit wieder. Dagegen war ihm bei den Berichten der Augenzeugen etwas anderes aufgefallen: Häufig war vom französischen Widerstand die Rede. War die Holzbombe also das Signal, dass die Aufklärungsdienste funktioniert hatten?
Andererseits: Auch die Deutschen konnten auf diese Weise erfahren, dass der Widerstand ganze Arbeit geleistet hatte. Was also steckte tatsächlich dahinter? Courouble hätte das gern einen Veteranen der Royal Air Force (RAF) gefragt, einen, der selbst eine solche Holzbombe abgeworfen hatte. Doch er fand keinen.
Wer sich bei ihm meldete, waren Kinder von Weltkriegsveteranen, die ihre Väter von Holzbomben hatten reden hören - jedoch ohne Details zu kennen. Der Krieg lag inzwischen mehr als 60 Jahre zurück, die meisten Piloten lebten nicht mehr oder konnten nicht mehr befragt werden.
Eine neue Spur
Stuart Usher, ein ehemaliger Fotograf der britischen Luftstreitkräfte, immerhin schrieb: "Ich bin geneigt zu glauben, dass sich diese Geschichten wirklich ereignet haben." Er vermute, dass es sich dabei um einen "Akt der Belustigung über den Feind" gehandelt habe, weniger um einen offiziellen Vorgang. Ob "solche Dummheiten" registriert wurden, "hing von der Einstellung des Staffelkommandeurs ab". Eine ähnliche Ansicht vertrat auch David Whiting, ehemaliger Ingenieur der britischen Luftfahrt und Adoptivsohn von Lord Downing, dem Kommandeur der RAF während der Schlacht um England. Auch Whiting hielt die Abwürfe für ein Werk der Beobachtungs- und Aufklärungseinheiten.
Den Einwand, dass solche Art von Humor zu riskant gewesen wäre, ließ er nicht gelten. Durch ihre Zuträger aus dem französischen Widerstand hätten die britischen Aufklärer gewusst, dass die wenigsten Scheinflugplätze über eine eigene Flugabwehrverteidigung verfügten.
Blieb die Frage, ob es sich tatsächlich um vereinzelten "Dummheiten" oder doch gezielte Aktionen handelte. Denn Courouble hatte auch Hinweise auf die britische Geheimdiensteinheit Special Operations Executive (SOE) erhalten. Der Nachrichtendienst für Spezialoperationen agierte weitgehend autonom. Seine Aufgabe war es, gesellschaftliche Umsturzversuche und die Widerstandsbewegungen in den besetzten Gebieten zu unterstützen.
Demnach könnte es durchaus im strategischen Interesse gelegen haben, die Deutschen moralisch zu schwächen, indem man sie wissen ließ, dass man ihre Tricks durchschaut hatte. Der Bevölkerung in den besetzten Gebieten wiederum machte man mit solchen Signalen womöglich Mut zum Widerstand. Prüfen konnte Courouble seine Hypothese nicht: Ein Brand hatte Ende 1945 das Archiv des SOE fast vollständig zerstört.
Die Entdeckung
Dann aber schien der französische Hobbyhistoriker doch noch fündig zu werden: Wenn schon nicht hinsichtlich des Piloten, so immerhin bezüglich der Munition. Er entdeckte sie in einem Film, einer Dokumentation des Kanadiers Robert Verge zum 50. Jahrestag der Landung in der Normandie. Ganz am Rande ging es dabei auch um eine Holzbombe - ausgestellt im Museum der US-Fallschirmjäger in Sainte-Mère-l'Eglise.
Courouble fuhr zu diesem Museum, stand vor einer Vitrine und las: "Holzbombe, abgeworfen 1944 von der alliierten Luftwaffe auf einen deutschen Scheinflugplatz in der Normandie. Die alliierten Piloten hatten Sinn für Humor!" Was vor ihm lag, war ein Geschoss von kaum 40 Zentimetern Länge und zwölf Zentimeter Durchmesser. Der Museumsdirektor erzählte ihm, dass ein US-Veteran sie 1970 dem Museum geschenkt und dazu erklärt hatte, dass es sich um eine Übungsbombe handle, amerikanische und britische Piloten sie aber auch benutzt hätten, um sie zum Spaß auf deutsche Scheinflugplätze zu werfen.
Das Projektil war hohl, hatte vorne und hinten eine Öffnung und im Inneren Brandspuren. Es war ursprünglich eine der schwimmenden Rauchbomben, die in großer Zahl in den USA hergestellt worden waren und üblicherweise für Markierungen auf See und auf dem Lande verwendet wurden.
Courouble gelang es, drei solcher Exemplare zu erwerben. Er packte sie ein und fuhr damit ins Département Pas-de-Calais an den ehemaligen Atlantikwall.
Noch ein Zeuge
Dort, zwischen Prédefin und Heuchin, hatten die Deutschen Ende 1943 ein Zentrum für Funkortung eingerichtet. Die Radarstation zur Luftverteidigung des Reiches war mit einem Peilgerät ausgestattet, das 30 Meter in die Höhe ragte. Um die Alliierten zu täuschen, war zwei Kilometer entfernt davon eine hölzerne Scheinanlage errichtet worden.
Der Mann, den Courouble im Pas-de-Calais aufsuchte, hatte daran mitgebaut - auf Befehl der Deutschen. René Merlier hatte außerdem gesehen, wie später Holzbomben darauf fielen. Sie seien aus einem kleinen Aufklärungsflugzeug abgeworfen worden, hatte der Landwirt erzählt. Als Courouble schließlich seine drei jüngst erworbenen Rauchbomben aus der Tasche holte, rief der alte Merlier erstaunt aus: "Ah! Ja! So sahen sie aus!"
Courouble war zufrieden. Er hatte das Rätsel der Holzbomben zwar nicht vollständig klären können, schrieb er später in seinem Buch, viele Fragen blieben offen. Doch die Geschichte seines Vaters schien tatsächlich glaubhaft. Zudem habe er den Eindruck gehabt, dass auch der alte Merlier sehr zufrieden gewesen sei mit dem "jungen Forscher", der ihm nach mehr als 60 Jahre den Beweis dafür lieferte, dass er sich nicht getäuscht hatte.>
========
29.6.2012: Buchautor über die Gestapo Hitlers: <"Von der Gestapo geselbstmordet">
aus: Der Standard online; 29.6.2012;
http://derstandard.at/1339639374052/Suizid-im-Nationalsozialismus-Von-der-Gestapo-geselbstmordet
Buchempfehlung: Christian Goeschel: "Selbstmord im Dritten Reich". Aus dem Englischen von Klaus Binder. Euro 21,90 / 338 Seiten. Suhrkamp, Berlin 2011
<Vielschichtiges Thema voller Widersprüche: Christian Goeschel über den Suizid im Nationalsozialismus.
Zum Selbstmord vertraten die Nazis eine ganz klare Position: "Das Leben des Einzelnen gehört dem Volke", schrieb Hitlers Kanzleileiter Martin Bormann im Mai 1944: "Er kann daher seinem Leben nicht willkürlich ein Ende bereiten. Tut er es doch, vergisst er damit seine Pflicht gegenüber seinem Volke. Das gilt besonders jetzt im Kriege." Trotzdem endete das "Dritte Reich" bekanntlich in einer "Orgie von Selbstmorden" (Goeschel). Von Adolf Hitler und Eva Braun bis hinab zum einfachen Parteimitglied nahmen sich Tausende von Nazis 1945 das Leben. Auch Bormann: Als man sein Skelett im Dezember im Jahr 1972 in der Nähe des Lehrter Bahnhofs fand, entdeckte man zwischen den Zähnen Glassplitterchen einer Giftampulle.Selbstmord im Dritten Reich - das ist ein vielschichtiges Thema voller Widersprüche. Der in London lehrende Historiker Christian Goeschel hat ihm eine Studie gewidmet, die nicht nur vorzüglich lesbar ist, sondern in ihrer multiperspektivischen Herangehensweise auch beispielhaft.
Goeschel untersucht auf drei Ebenen: auf der der zeitgenössischen medizinischen oder kulturellen Debatten, auf der von Statistik und gesellschaftlichen Veränderungen und auf der des Individuums. Für letztere Ebene erweist sich eine von dem legendären Berliner Kriminalisten Ernst Gennat (1880-1939) angelegte Sammlung von Abschiedsbriefen, von der Forschung bisher ignoriert, als ergiebige Quelle, korrigiert der Blick auf Einzelschicksale doch beliebte zeitgenössische Erklärungsmuster.
Gesellschaftlicher Indikator
Grundsätzlich war Selbstmord für die NS-Führung ein Problem der verhassten Weimarer Republik, das es im "Dritten Reich" nicht mehr geben sollte. Die hohen, auch in der Öffentlichkeit kontrovers diskutierten Selbstmordraten in den 1920er-Jahren wurden von den Nazis instrumentalisiert, indem man sie auf die Arbeitslosigkeit infolge des Versailler Vertrags zurückführte. Nach 1933 ließ sich Hitler von Goebbels regelmäßig über die Suizidzahlen informieren, die er als Indikator für die gesellschaftliche Entwicklung betrachtete. Bemerkenswerterweise änderte sich aber rein statistisch gesehen wenig, die Rate blieb hoch (verglichen etwa mit der Zeit vor 1914), weshalb die Nazis die Zahlen nicht mehr veröffentlichen ließen.
Für Goeschel bezeugt Bella K.s Freitod, dass es auch in der NS-Zeit wie zu allen Zeiten Selbstmorde aus privaten oder ökonomischen Gründen gab. Es gab aber auch, auf den ersten Blick überraschend, gerade nach der "Machtergreifung" Suizide in den Reihen der Nazis: Goeschel schildert Fälle von SA-Männern, die sich - frustriert von der Entmachtung der SA im Sommer 1934 - das Leben nahmen, um ihre "Ehre" zu retten.
Hinzu kamen freilich Suizide als Folge des NS-Terrors wie der Selbstmord des Stuttgarter Geschäftsmanns und Turnvereinsmitglieds Fritz Rosenfelder im Sommer 1933, den der Stürmer zynisch als positiven Beitrag zur Lösung der "Judenfrage" begrüßte. Besonders in der Anfangszeit des Regimes zeigte sich die für das "Dritte Reich" typische "unscharfe Trennung von Mord und Selbstmord", so Goeschel. Für den Umgang mit Regimegegnern wurde etwa der Spruch "von der Gestapo geselbstmordet" zum geflügelten Wort; Erich Mühsams Tod 1934 im KZ Oranienburg ist dafür ein berühmtes Beispiel.
Für die späteren Jahre ist der Zusammenhang zwischen den Eskalationsstufen des Holocausts und den Selbstmordzahlen deutscher Juden unverkennbar: Bereits infolge der "Reichskristallnacht" 1938 nahmen sich Hunderte das Leben (viele erinnerten in ihren Abschiedsbriefen an ihre Leistungen fürs Vaterland etwa im Ersten Weltkrieg). Einigen stellten die Nazis noch "Bitte nachmachen"-Schilder ins Schaufenster.
Nach 1941 führten die Deportationen zu drei- bis viertausend Selbstmorden von Juden, im Herbst 1942 wurden drei Viertel aller Suizide in Berlin von der jüdischen Minderheit begangen. Doch wäre es nicht angemessener, auch hier von Mord zu sprechen?
Für Goeschel erlaubt es aber der Blick aufs Individuum, den Suizid als - womöglich einzig noch möglichen - "Akt der Selbstbehauptung" im totalitären nationalsozialistischen System zu verstehen. "Deutsche Juden, die Selbstmord begingen, waren nicht einfach passive Opfer, für sie war Selbstmord die letzte Möglichkeit, Würde und Selbstbestimmung zu wahren." Dass die Nazis in dieser Zeit längst dazu übergegangen waren, jüdische Suizidversuche, selbst noch in den Vernichtungslagern, streng zu bestrafen, betrachteten sich die Nazis doch als alleinige Herren über Leben und Tod, spricht für dieses Urteil. (Oliver Pfohlman, Album, DER STANDARD, 30.6./1.7.2012)>
========
14.7.2012: Unangenehme Wahrheiten über die Ostfront - Historiker Pfeiffer über die Aussagen seines Grossvaters
aus: Welt online: Kriegserinnerungen: Bei den Kämpfen an der Ostfront weicht Hans K. aus; 14.7.2012;
http://www.welt.de/regionales/duesseldorf/article108287845/Bei-den-Kaempfen-an-der-Ostfront-weicht-Hans-K-aus.html
<Der junge Historiker Moritz Pfeiffer hat seinen Großvater nach dessen Kriegserinnerungen befragt. Dabei stieß er auf Ungereimtheiten und Widersprüche – und fand unangenehme Wahrheiten.
Von Andreas Fasel
Ein Enkel befragt seinen Großvater: Es geht um dessen Kriegserlebnisse. Der Großvater war Soldat, erst Frankreich, dann Russland. Nachdem er durch einen Granatsplitter sein rechtes Auge verlor, wurde er wieder in Frankreich eingesetzt. Nach den Interviews mit dem Opa verteilt der Enkel die achtzigseitige Niederschrift der Gespräche als Weihnachtsgeschenk in der aus Wuppertal stammenden Familie. Alle sind begeistert. Doch der Enkel ist nicht zufrieden. Denn nicht alles, was der Großvater erzählt hat, erscheint ihm bei der neuerlichen Lektüre schlüssig.
Immer wieder tauchen Widersprüche und Ungereimtheiten auf. Zum Beispiel bei der Frage, ob er während des Russlandfeldzuges von den Erschießungsbefehlen des Oberkommandos der Wehrmacht gewusst habe. Der Großvater antwortet, er sei "hinter den Kampftruppen, die überhaupt Gefangene machten", gewesen und habe solche Befehle nicht erhalten und auch nicht gekannt.
Doch dann, "noch im gleichen Atemzug", beschwert er sich darüber, dass er als Teil der "vordersten Truppe" nichts von der in der Heimat gesammelten Winterkleidung gesehen habe. "Wo befand er sich denn nun?", fragt sich der Enkel: "Hinter den Kampftruppen, die Gefangene machten, oder an vorderster Front?"
Unvermögen und Unwillen
Der Enkel Moritz Pfeiffer, geboren 1982, damals noch Student der Geschichte, nahm sich daraufhin vor, die Erinnerungen seines Großvaters Hans Hermann, Jahrgang 1921, einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Er hat nach Quellen und Akten gesucht, Kriegstagebücher und Weltkriegsanalysen studiert und die daraus gewonnenen Erkenntnisse mit den Berichten seines Großvaters verglichen.
Erst verarbeitete Pfeiffer diese Synopse von persönlicher Erinnerung und historischer Forschung für seine Magisterarbeit, die der Freiburger Militärhistoriker Wolfram Wette als "exemplarische intergenerationelle Auseinandersetzung" lobte. Und nun hat Pfeiffer, mittlerweile wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Gedenkstätte Wewelsburg, ein überaus lesenswertes und lehrreiches Buch daraus gemacht. Es ist auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft – und zugleich dicht am Empfinden eines ehemaligen Soldaten, der zeitlebens mit seinen traumatischen Erlebnissen und dem Bewusstsein, Teil der NS-Diktatur gewesen zu sein, fertigwerden musste.
Immer wieder stößt Pfeiffer bei seinem Großvater auf einen "Unwillen, sich die Grausamkeiten noch einmal zu vergegenwärtigen", auf ein "Unvermögen, die brutalen Geschehnisse in Worte zu fassen" und auf die "Tendenz zur Tabuisierung". Wirkliche Kriegserlebnisse klammert er aus, stattdessen schweift er in Berichte über Alltäglichkeiten und Familiengeschichten ab.
Auch bei den Schilderungen der Kämpfe an der Ostfront weicht er aus. Es habe "keinen Zweck, jetzt so ins Detail zu gehen". Weil der Großvater ansonsten mit einem detailgenauen Gedächtnis gesegnet ist, kommt sein Enkel zu dem Schluss, "dass diese Geschehnisse viel eher nicht erzählbar als nicht erinnerbar sind".
"Waren meine Großeltern Nazis?"
Die Arbeit an diesem Buch sei "manchmal unangenehm und schmerzhaft" gewesen, schreibt Pfeiffer. Denn immer findet er heraus, dass die Erzählungen des früheren Leutnants der 79. Infanteriedivision lückenhaft und mitunter sogar falsch sind. Er findet Belege für "Verharmlosung" und "konsequente Selbsttäuschung". So zum Beispiel sei "die Behauptung, seine Einheit habe keine Gefangenen gemacht, nicht zutreffend", schreibt Pfeiffer.
Allein für den Zeitraum vom 5. bis 31. August 1941 verzeichnet das Kriegstagebuch der 79. Infanteriedivision die Gefangennahme von 5088 russischen Soldaten." Und weiter: "Meinem Großvater oblag gemäß der Befehlslage die Pflicht, als Frontoffizier und zeitweiligem Kompanieführer bei der Gefangennahme von sowjetischen Soldaten die politischen Kommissare ,abzusondern' und auf Befehl ,erledigen' zu lassen."
Und auf die Frage "Waren meine Großeltern Nazis?" gibt Pfeiffer eine Antwort, die so deutlich in der Familie zuvor nicht ausgesprochen wurde: "Ja, sie waren vom Nationalsozialismus überzeugt und – was vielleicht in seinen Auswirkungen schwerer wiegt – sie glaubten an ihn." Juristisch könne man sie zwar als "minderbelastet" bezeichnen, schreibt er, aber nach moralischen Kriterien "müsste ich meine Großeltern als ,belastet' einstufen".
Liebe und Respekt
In der Zusammenfassung und auf den ersten Blick mag das wie eine kaltherzige Abrechnung des Enkels mit seinem Großvater erscheinen. Tatsächlich aber geht es in diesem Buch nicht um Bloßstellung oder Anklage. Denn dieses Opa-Enkel-Verhältnis ist von Liebe und Respekt durchdrungen – und daran habe auch die Arbeit an diesem Buch nichts verändert, schreibt Pfeiffer. Auch wenn das vermutlich nicht seine ursprüngliche Absicht war, so begreift er doch die Lücken und Fehler in den Erzählungen immer mehr als Aufforderung, dem Großvater über sein Nicht-darüber-sprechen-Können und -Wollen hinwegzuhelfen.
So wird aus dieser vordergründig historischen Arbeit auch eine einfühlsame Studie darüber, warum und wie es gerade der Enkelgeneration gelingen kann, ein innerfamiliäres Schweigen über die Nazi-Zeit zu durchbrechen. Gerade weil es hier nicht um die Haupttäter des NS-Regimes geht, sondern um eine ganz normale Familie aus Wuppertal.
Zwar erlebte Pfeiffers Großvater die Veröffentlichung dieses Buchs nicht mehr (er starb 2006, ein Jahr nach den Interviews mit dem Enkel), dennoch gibt es Hinweise, die darauf hindeuten, dass auch der Großvater einverstanden, wenn nicht gar froh darüber war, dass sein Enkel mehr erfahren wollte als nur ein paar schauerliche Episoden aus dem Krieg.
Pfeiffer berichtet, wie er kurz nach den Interviews eine Hausarbeit mit dem Titel "Schuld und Untergang" schrieb, in der er der Frage nachging, "ob ein mit den verübten Verbrechen einhergehendes Schuldbewusstsein der Grund dafür war, die militärisch absehbare Niederlage möglichst lange hinauszuzögern und der Sieg-oder-Untergang-Parole zu folgen". Pfeiffer gelangte zu der Überzeugung, das es dieses Schuldbewusstsein gegeben haben muss. Als er seinem Großvater die Arbeit zum Lesen gab, war der zunächst empört, "vor allem über das Kapitel über die Beteiligung der Wehrmacht an Kriegsverbrechen".
Der Bruder in Auschwitz
Vom eigenen Enkel "hintergangen und womöglich durchschaut" habe sich der Großvater da gefühlt. Doch im Verlauf einiger Wochen habe er seine Meinung geändert: "Ich habe viel drüber nachgedacht", sagte er da zu seinem Enkel: "Und es ist was Wahres dran." Daraufhin ließ der Großvater diese Seminararbeit binden und gab sie Freunden und Verwandten zum Lesen. Der Mann, dem es zeitlebens unmöglich war, offen über seinen eigenen Anteil an den Verbrechen der NS-Diktatur und die Frage nach einer Mitverantwortung zu sprechen, benutzte die Hausarbeit des Enkels als "nonverbales Schuldeingeständnis", wie Pfeiffer schreibt.
Kurz vor dem Tod des Großvaters wollte der Enkel noch einmal mit ihm sprechen. Reichlich vage war zum Beispiel geblieben, was der Großvater über das Schicksal seines jüngeren Bruders Siegfried wusste, der sich zur Waffen-SS gemeldet hatte und in Russland verschollen war. Pfeiffer schreibt diesen Dialog wörtlich auf.
Es ist eine eindringliche Szene, in der der Leser spürt, wie der Großvater mit sich ringt. Nach wie vor ungern spreche er über seinen Bruder, so beginnt der Großvater. Der Enkel fragt nach: Ob er nicht Bescheid wisse – oder ob er nicht darüber reden wolle. "Also", sagt der Großvater und macht danach eine lange Pause. Dann sagt er: "Er war da." Pause. "Wo?", fragt der Enkel. Wieder Pause. Dann: "Auschwitz."
Die Verantwortung zu lernen
Und plötzlich verstand Moritz Pfeiffer, was es mit den Andeutungen über die Einsätze Siegfrieds auf sich hatte, die er etwa in Briefen seiner Großmutter gefunden hatte. Seine Großeltern hatten entgegen ihrer späteren Beteuerungen also sehr wohl Kenntnisse über die Vorgänge in Osteuropa, "die Reflexion darüber vermieden sie jedoch", schreibt Pfeiffer bitter. Seine Befürchtung, "dass der Völkermord womöglich weit in die Familiengeschichte hineinreichte, war offensichtlich berechtigt".
In Diskussionen wird häufig der Vorwurf laut, man dürfe sich nicht über die Kriegsgeneration erheben, niemand könne mit Sicherheit sagen, dass er sich in der damaligen Situation besser oder moralischer verhalten hätte. Moritz Pfeiffer findet darauf eine verblüffend einfache Antwort. Er schreibt in seiner Schlussbetrachtung über die Verantwortung, aus der Vergangenheit zu lernen – um eben nicht in dieselbe Gefahr zu geraten, "in der sich meine Großeltern befunden haben. Damit überhebe ich mich keineswegs über sie, sondern stelle für mich klar, dass ihr Handeln im Dritten Reich für mich heute keine Geltung hat.">
========
21.7.2012: Der Kunstzensor Adolf Ziegler, der "entartete Kunst" definierte
aus: Kunst im "Dritten Reich" Hitlers Pinselführer; 21.7.2012;
http://einestages.spiegel.de/s/tb/25208/entartete-kunst-ns-propagandaausstellung-1937-in-muenchen.htmlBuchempfehlungen:
-- Hans-Joachim Manske, Birgit Neumann-Dietzsch (Hg.): "Entartet" - beschlagnahmt. Bremer Künstler im Nationalsozialismus, Bremen 2009.
-- Gerhart, Nikolaus und Walter Grasskamp (Hg.): 200 Jahre Akademie der Bildenden Künste München. Kein bestimmter Lehrplan, kein gleichförmiger Mechanismus, München 2008.>
Link
-- Link zum Archiv der "Entarteten Kunst": http://emuseum.campus.fu-berlin.de/eMuseumPlus
Bildertexte:
<1. Adolf Ziegler: Durch die richtigen Bekanntschaften und ein NSDAP-Parteibuch mit niedriger Mitgliedsnummer stieg der Bremer Maler 1936 zum "Sachberater für Bildende Kunst" in der Reichsleitung der Partei und Präsident der Reichskunstkammer auf.
Seine eigenen Aktmalereien, die erst an Bedeutung gewannen, nachdem er sie selbst in die "Große Deutsche Kunstausstellung" gehängt hatte, brachten ihm den Spitznamen "Meister des deutschen Schamhaars" ein.
Ziegler war zuständig für die Auswahl der als "entartet" zu beschlagnahmenden Kunstwerke und organisierte die Ausstellung dazu.
Für die Nazis führte Adolf Ziegler den Kulturkampf gegen die Malerei - und eröffnete vor 75 Jahren die Ausstellung "Entartete Kunst". Als Maler brachte es der Präsident der Reichskunstkammer allerdings nur zu zweifelhaftem Ruhm: Das Volk kannte ihn als "Meister des deutschen Schamhaars".
Beide waren Kunstmaler, und beide waren zu dieser Zeit dem Expressionismus zugetan. In Abendkursen an der Kunstgewerbeschule hatte Radziwill das figürliche Zeichnen gelernt. Doch nachdem er als Soldat aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt und mit der Berliner Künstlergruppe um Otto Dix in Berührung gekommen war, radikalisierte sich sein Stil. Ziegler orientierte sich eher an Franz Marc und Emil Nolde, er malte zu dieser Zeit düstere, pessimistisch wirkende Portraits.
2. "Halbakt": Das Gemälde des deutschen Künstlers Alexej von Jawlensky aus dem Jahre 1912 war eines seiner insgesamt 72 Werke, die 1937 von den Nazis als "Entartete Kunst" beschlagnahmt wurden. Jahrelang hatte es sich in der Sammlung der Familie Beck befunden, die es sich als Betreiber eines erfolgreichen Sanitär-Unternehmens hatten leisten können, den von den Nationalsozialisten geächtete Künstler zu unterstützen. Das Bild wurde am 18. Juli 2002 bei einer Auktion von Sotheby's in London für einen Rekordpreis von 2,2 Millionen Euro versteigert.
3. "Joseph und Potiphar": Der Bildhauer Christoph Voll hatte seit 1925 als Kunstprofessor gearbeitet, bevor die Nationalsozialisten sein Schaffen als "entartet" brandmarkten und ihm Berufsverbot erteilten. 43 seiner Werke wurden beschlagnahmt, darunter auch diese Holzskulptur, die 1937 in der Ausstellung in München gezeigt wurde. Voll starb 1939 im Alter von nur 42 Jahren.
4. "Tanzpaar": Der in der Schweiz lebende Ernst Ludwig Kirchner war in den zwanziger Jahren einer der führenden Expressionisten. Er gilt als Mitbegründer dieser Kunstrichtung. Ab 1936 durften seine Werke nicht mehr in Deutschland ausgestellt werden, 688 wurden beschlagnahmt. In der Ausstellung "Entartete Kunst" waren 33 noch einmal zu sehen - darunter das "Tanzpaar". Tief enttäuscht über die Ächtung seiner Bilder und seit Jahren morphiumabhängig nahm sich Kirchner 1938 das Leben. Heute hängt sein "Tanzpaar" wieder im Museum Folkwang in Essen, von wo es einst abtransportiert worden war.
5. "Ecce Homo": Während Lovis Corinths impressionistisches Frühwerk von den Nationalsozialisten durchaus als "deutsch" geschätzt wurde, waren seine späteren expressionistischen Bilder als "entartet" verachtet. Die Wandlung des Malers erklärte man sich durch einen Schlaganfall, den er 1911 erlitten hatte. 295 seiner Werke wurden beschlagnahmt und teilweise 1937 in München gezeigt. Darunter war auch dieses Bild von 1925 mit dem Titel "Ecce Homo". Ein Großteil von Corinths Bildern wurde schließlich ins Ausland verkauft. "Ecce Homo" hängt heute im Kunstmuseum Basel.
6. "Verhöhnung der deutschen Frau": Dieses Motto hatten die Nationalsozialisten dem Raum im Obergeschoss gegeben, in dem sie die nach ihrem Urteil "entartete" Aktkunst ausstellten - darunter "Die Badende", eine Holzskulptur von Ernst Ludwig Kirchner.
7. "Männer am Meer": Erich Heckel, der neben Ernst Ludwig Kirchner und Karl Schmidt-Rottluff zu den Gründern der Dresdner Künstlergruppe "Brücke" gehörte, malte 1916 Soldaten eines Sanitätszuges beim Baden im Meer. Da diese Darstellung von Soldaten als menschlich und verwundbar nicht in das Weltbild des Nationalsozialismus passte, wurden die "Männer am Meer" mit knapp 730 anderen Werken Heckels beschlagnahmt, ein Großteil davon 1939 verbrannt.
Dieses Gemälde befand sich jahrelang in Privatbesitz und kehrte erst im Februar 2012 ins Albertinum in Dresden zurück.
8. Besucherrekord: Die Ausstellung "Entartete Kunst" zählte - bei freiem Eintritt - nach offiziellen Angaben rund zwei Millionen Besucher. Wer allerdings den Eindruck erweckte, dass er sich tatsächlich für die Exponate interessierte, wurde vom Aufsichtspersonal rasch weitergeschickt. Die zur gleichen Zeit ebenfalls in München stattfindende "Große Deutsche Kunstausstellung" mit den Werken der NS-Kunst sahen hingegen nur rund 400.000 Interessierte.
9. "Groteske Köpfe (Leidenschaft und Ruhe)": So hatte der deutsche Expressionist Christian Rohlfs 1915 einen Linolschnitt genannt - ausgestellt 1937 in München in der Ausstellung "Entartete Kunst". Rohlfs war kein Unbekannter, Propagandaminister Goebbels erwähnte ihn 1937 sogar in seinem Tagebuch: "Mit Vetter Thema entartete Kunst. Er wollte Rohlfs in Schutz nehmen. Aber ich heile ihn."
10. "Das Leben Christi": Der Maler Emil Nolde hatte sich selbst immer als Nationalsozialist begriffen. Es traf ihn daher schwer, als seine Kunst als "entartet" bezeichnet wurde. Nachdem der Expressionist 1941 ein Malverbot bekam, zog er sich nach Seebüll in Nordfriesland zurück und malt nur noch heimlich. In der Münchner Ausstellung "Entartete Kunst" wurde 1937 sein Bild "Das Leben Christi" gezeigt. Es hatte bereits 1912 für großen Wirbel gesorgt, als es aufgrund von Protesten der Kirche aus der "Ausstellung für religiöse Kunst" in Brüssel ausgeschlossen worden war.
11. "Ideologisch wertvoll": Am 19. Juli 1937 begrüßte Adolf Ziegler (ganz rechts in Rückenansicht) die NS-Größen Hermann Göring, Gerdy Troost, Adolf Hitler und Joseph Goebbels zur Eröffnung der von ihm mitorganisierten "Großen Deutschen Kunstausstellung" im Haus der Deutschen Kunst in München. Alles, was dem als Künstler erfolglosen Hitler gefiel, hing hier an den Wänden - auch Zieglers barbusige Arierinnen.
12. "Das Zelt": Das um 1927 entstandene Gemälde von Otto Mueller war eines von 13 Werken des Expressionisten, die 1937 in der nationalsozialistischen Ausstellung "Entartete Kunst" in München zu sehen waren. Als Ausdruck der Einheit von Mensch und Natur hatte Mueller häufig Szenen aus dem Zigeunerleben gemalt - und wohl nicht zuletzt damit die Rasseideologen gegen sich aufgebracht. Heute hängt "Das Zelt" heute im Institute of Arts in Detroit.
13. "Das Zelt": Das um 1927 entstandene Gemälde von Otto Mueller war eines von 13 Werken des Expressionisten, die 1937 in der nationalsozialistischen Ausstellung "Entartete Kunst" in München zu sehen waren. Als Ausdruck der Einheit von Mensch und Natur hatte Mueller häufig Szenen aus dem Zigeunerleben gemalt - und wohl nicht zuletzt damit die Rasseideologen gegen sich aufgebracht. Heute hängt "Das Zelt" heute im Institute of Arts in Detroit.
14. "Eber und Sau": In der Ausstellung in München wurden insgesamt fünf Werke des Malers Franz Marc gezeigt, darunter auch "Eber und Sau" von 1913. Nach einer Intervention des "Deutschen Offiziersbundes" wurde zumindest das Bild "Der Turm der blauen Pferde" wieder aus der Schau entfernt. Marc, der sich freiwillig zum Ersten Weltkrieg gemeldet hatte, war 1916 in der Schlacht von Verdun gefallen.
15. "Kleiner Kopf aus Gips": Otto Freundlich, einer der ersten Vertreter der abstrakten Kunst, hatte ab 1924 in Paris gelebt, wo er zu Beginn des Zweiten Weltkriegs interniert wurde. Zwar kam er auf Betreiben Picassos schnell wieder frei, wurde aber 1943 erneut verhaftet und schließlich im KZ Lublin-Majdanek ermordet.
Bereits 1912 hatte er die Plastik "Der neue Mensch" geschaffen, einen riesigen Kopf aus Stein, der symbolisch für den erhofften Neubeginn dieser Zeit stand. Diese Skulptur wurde von den Nationalsozialisten nicht nur in der Ausstellung "Entartete Kunst" gezeigt, sondern prangte auch auf der Titelseite des Katalogs. Während die Ausstellung durch verschiedene Städte wanderte, ging die Skulptur verloren und gilt bis heute als verschollen.
1916 hatte Otto Freundlich diese kleinere, sehr ähnliche Ausgabe der Skulptur "Kleiner Kopf aus Gips" angefertigt.
16. "Das Paar": Nicht nur den Künstler Ernst Ludwig Kirchner, sondern auch den ehemalige Direktor des Hamburger Museums für Kunst und Gewerbe, Max Sauerland, wollten die Nationalsozialisten verhöhnen, als sie in der Ausstellung explizit auf den Kaufpreis der Holzskulptur hinwiesen. 3000 Reichsmark hatte das Museum 1930 für die Figur ausgegeben. Sauerland hatte sich während seiner Zeit als Direktor für viele junge Expressionisten eingesetzt und deren Existenz durch verschiedene Ankäufe gesichert. Gleich 1933 verlor er seinen Posten als Museumsleiter, bald darauf auch seinen Lehrstuhl an der Universität Hamburg. Er starb am Neujahrstag 1934 an einem Magenkarzinom.
17. "Männliches Bildnis": So nannte Hanns Ludwig Katz diese Arbeit, die um 1920 während der Revolutionskämpfe in München entstanden war. Nachdem die Nationalsozialisten an die Macht gekommen waren, floh Katz 1936 nach Südafrika. Doch auch dort wurde ihm die gebührende Anerkennung verweigert, eine Ausstellung seiner Werke verhindert. Katz litt sehr unter der intellektuellen Isolation und starb 1940 an Krebs. Erst in den neunziger Jahren begann die Kunstwelt sich für den vergessenen Maler zu interessieren.
18. "Wahnsinn wird Methode" pinselten die Nationalsozialisten 1937 an die Wand jenes Raumes in der Ausstellung, in der sie fünf Bilder von Johannes Molzahn zeigten. Der Diffarmierung seiner Werke überdrüssig, verließt der gebürtige Duisburger bald darauf Deutschland, ging ins amerikanische Exil und kehrte erst 1959 wieder zurück.
19. Beschlagnahmt: Der Depotraum im Schloss Niederschönhausen in Berlin quoll über - innerhalb nur weniger Monate waren an die 20.000 Kunstwerke aus Museum, Sammlungen und Galerien geholt worden. Dabei hatte die Aktion offenbar nicht nur ideologische Gründe: Viele der beschlagnahmten Werke verkauften die Nazis anschließend ins Ausland.
20. Abgehängt: Der in München geborene Maler und Grafiker Walter Dexel muss schockiert gewesen sein, als er seine "Abstrakte Komposition" 1937 unter den Werken der "Entarteten Kunst" in der gleichnamigen Münchner Ausstellung fand. Der Kunsthistoriker, der 1933 in die NSDAP eingetreten war, protestierte - mit Erfolg: Seine Arbeiten wurden daraufhin aus der Ausstellung entfernt.
21. "Der Goldfisch": Der Maler Paul Klee war erst 1931 auf einen Lehrstuhl an der Düsseldorfer Kunstakademie berufen worden - doch schon 1933 wurde er fristlos entlassen und durch Franz Radziwill ersetzt. Klee emigrierte in die Schweiz. In Deutschland wurden 102 seiner Werke als "entartet" beschlagnahmt und ins Ausland verkauft. Unter den in der Münchner Ausstellung von ihm gezeigten Bildern war "Der Goldfisch" von 1925. Heute hängt das Gemälde wieder in der Kunsthalle in Hamburg.
22. "Nach dem Bade": Max Pechsteins kolorierte Lithografie von 1923 im Januar 2009 in der Rostocker Kunsthalle. Das Bild war in dem Jahr entstanden, in dem ihn die Preußische Akademie der Künste zum Professor berief. 1933 setzten ihn die Nationalsozialisten ab und erteilten ihm Ausstellungsverbot. Während der NS-Zeit waren seine Bilder in Deutschland ausschließlich in der Ausstellung "Entartete Kunst" zu sehen.
23. "Reichsschamhaarmaler": So spottete das Volk über den arrogant erscheinenden Schönling Adolf Ziegler (2.v.r.), wenn dieser nicht gerade in Hörweite war. Als Künstler wenig erfolgreich war Hitlers liebster Aktmaler zum Präsidenten der Reichskammer der Bildenden Künste aufgestiegen. Zusammen mit Hitler und Propagandaminister Goebbels (r.) besuchte er am 5. Mai 1937 das Haus der Deutschen Kunst in München. >
Der Artikel:
<Von Solveig Grothe
Besonders gemocht haben sie sich wohl nie, der etwas poltrige Franz Radziwill aus der Wesermarsch und der knapp drei Jahre ältere, elegant zurückhaltende Bremer Adolf Ziegler. Schon damals nicht, als sie noch in den Kreisen der Kreativen von Bremen und Fischerhude verkehrten und beide Künstlerkollegen noch am Anfang ihrer Karriere standen. Radziwill war eher der Bodenständige, Ziegler ein arroganter Schönling.
Doch bald schon interessierte sich der Bremer Ziegler stärker für die klassische Malerei. Blumenstillleben und biedere Porträts im Stil der Alten Meister ließen sich eben besser verkaufen. Mit gefälligen Auftragsarbeiten verdiente Ziegler sein Geld, wobei die Bekanntschaft mit dem Industriellen Albert Pietzsch hilfreich war, dessen Adoptivtochter er Mitte der zwanziger Jahre heiratete. Pietzsch war ein Förderer der gerade gegründeten NSDAP; 1929 trat auch Ziegler ein. Und auch Radziwill, künstlerisch mittlerweile ebenfalls den Altmeistern zugewandt, versprach sich davon ab 1933 einen Karrierevorteil. Die Zeiten hatten sich geändert, selbst für Kunstmaler: Radziwill bemühte sich um einen Lehrstuhl und noch im gleichen Jahr durfte er die Nachfolge des von den Nationalsozialisten geschassten Paul Klee an der Düsseldorfer Kunstakademie antreten.
Wenig später war Radziwill im Deutschen Reich eine feste Größe: Sein Bild "Die Straße" hing 1934 während der Biennale in Venedig im deutschen Pavillon und war "lange vom Führer betrachtet" worden, wie Radziwill Ende 1937 an Ziegler schrieb. Der Anlass für den Brief war allerdings kein erfreulicher, denn Radziwills Bilder waren dem Regime offenbar plötzlich nicht mehr recht: Das Gemälde war beschlagnahmt worden, zudem 58 weitere seiner Arbeiten. Mehrmals war sein Atelier von der SS durchsucht, eigene Ausstellungen waren untersagt worden. Dass er sich in dieser Situation ausgerechnet an den wenig geliebten Kollegen aus alten Bremer Tagen wandte, hatte einen Grund: Adolf Ziegler, mittlerweile Präsident der Reichskammer der bildenden Künste, hatte all das veranlasst. Der Auftragsmaler war rechte Hand und williges Werkzeug von Hitler und dessen Propagandaminister Goebbels geworden.
Pinselführer mit steiler Karriere
Binnen kürzester Zeit war Ziegler vom Sachbearbeiter für bildende Kunst in der NSDAP-Reichsleitung zu einem der höchsten Kulturfunktionäre des "Dritten Reiches" aufgestiegen - und das, obwohl er künstlerisch fast nichts vorweisen konnte. Kein einziges Mal war eines seiner Bilder in einer Ausstellung gezeigt worden. Und als der "Vertragslehrer" für Maltechnik an der Münchner Kunstakademie 1934, nur ein Jahr nach seinem Engagement, bereits auf höhere Weisung zum Professor berufen werden sollte, musste das Kollegium mit Bedauern eine Stellungnahme ablehnen, "da ihm die Arbeiten Zieglers nicht bekannt seien".
Für Zieglers Karriere war die künstlerische Bedeutungslosigkeit kein Hindernis, seine Kontakte und das Parteibuch waren hingegen höchst förderlich. Noch 1934 wurde der Bremer Mitglied des Präsidialrats und Vizepräsident der Reichskammer der Bildenden Künste. 1936 hievte ihn Goebbels auf den Chefposten, und Hitler persönlich beauftragte ihn damit, aus allen im Reichs-, Landes- und Kommunalbesitz befindlichen Museen, Galerien und Sammlungen sämtliche Werke der im NS-Jargon "Verfallskunst" genannten Stilrichtungen zu beschlagnahmen. Jener Kunst, die nicht ins Weltbild der Nazis und zu deren Schönheitsidealen passte.
Das Kunstunverständnis der Nazis wurde spätestens am 19. Juli 1937 in München offenbar, als Ziegler eine Ausstellung eröffnete, in der rund 700 dieser verunglimpften und beschlagnahmten Werke gezeigt wurden: eine aufwändig inszenierte Propagandaschau zur Verhöhnung vor allem des Expressionismus unter dem diffamierenden Titel "Entartete Kunst".
Verhöhnt, verschachert, vernichtet
Überfallartig beschlagnahmten Zieglers Kommissionen in den folgenden Monaten bis zu 20.000 Werke. Offensichtlich nicht allein aus ideologischen Gründen: Was international "verwertbar" schien, wurde gegen Devisen verschachert oder im Ausland gegen "gute deutsche Kunst" eingetauscht. Der "Rest" wurde eingelagert und schließlich im März 1939 auf dem Hof der Berliner Hauptfeuerwache verbrannt. Auch Radziwills beschlagnahmte Werke hatten sich als unverkäuflich erwiesen.
Als Wanderausstellung war die "Entartete Kunst" noch bis Anfang der vierziger Jahre teils mit wechselnden Exponaten in verschiedenen Großstädten des Reiches zu sehen. Die Bilder und Skulpturen waren mit kruden Kommentaren und Schmähsprüchen versehen. Außerdem standen die Preise dabei, zu denen sie einst erworben worden waren - um nicht nur die Künstler, sondern auch die Museumsbeamten wegen der angeblichen Verschwendung von Steuergeldern zu brandmarken.
Von der augenscheinlich scheuen Zurückhaltung, die Ziegler laut Zeugen noch bei den Beschlagnahmungen an den Tag gelegt hatte, war bei seiner Brandrede zur Eröffnung der Ausstellung nichts zu spüren: Er habe die "traurige Pflicht zu erfüllen", suchte er das kulturelle Verbrechen als nationale Notwendigkeit zu glorifizieren, "dem deutschen Volk (…) vor Augen zu führen, dass bis vor nicht allzu langer Zeit Kräfte maßgeblichen Einfluss auf das Kunstschaffen nahmen, die in der Kunst nicht eine natürliche und klare Lebensäußerung sahen, sondern bewusst auf das Gesunde verzichteten und alles Kranke und Entartete pflegten und als höchste Offenbarung priesen."
"Meister des deutschen Schamhaars"
Die Worte des erfolglosen Pinselführers waren eine Drohung: "Die Geduld ist nunmehr für alle diejenigen zu Ende, die sich innerhalb der vier Jahre in die nationalsozialistische Aufbauarbeit auf dem Gebiet der bildenden Kunst nicht eingereiht haben; das deutsche Volk mag sie richten, wir brauchen dieses Urteil nicht zu scheuen." Sprachlich wie inhaltlich hatte sich der Reichskunstkammerpräsident damit bereits vollends auf die Linie seines Gönners Hitler gebracht, der einen "unerbittlichen Säuberungskrieg" gegen "die letzten Elemente unserer Kulturzersetzung" ausgerufen hatte. Und das nur einen Tag zuvor: Da hatte der Diktator als Gegenentwurf zur "Entarteten Kunst" in München die "Großen Deutsche Kunstausstellung" eröffnet.
Der Kreis derer, über die Ziegler sein Urteil gefällt hatte, war äußerst heterogen. Die "Säuberung der deutschen Kunst" ging mit großer Willkür einher, nicht selten "geprägt von persönlichen Befindlichkeiten", wie die Kunsthistoriker Birgit Neumann-Dietzsch am Beispiel der Karrieren von Radziwill und Ziegler feststellte. Während Radziwill seine Düsseldorfer Professur bereits 1935 wieder verlor und beim Regime in Ungnade fiel, nachdem er von Studenten ob seines expressionistischen Frühwerks denunziert worden war, machte Ziegler als Hitler-Günstling eine beispiellose Karriere.
Kennengelernt hatten sich Ziegler und der NSDAP-Demagoge Hitler Mitte der zwanziger Jahre über den Industriellen Albert Pietzsch. Hitler war begeistert: "Ziegler ist der beste Fleischmaler der Welt", soll er beim Anblick von dessen Aktbildern gesagt haben. Die Formen der aufreizend auf farbigen Tüchern und Sitzmöbeln drapierten Mädchen schienen Hitlers Ideal von den wohlgeformten Brüsten der Botticelli-Venus immerhin nahe zu kommen. Zieglers bekanntester Akt "Die vier Elemente" hatte es schließlich in die "Große Deutsche Kunstausstellung" geschafft - wenig überraschend, war die Schau doch von Ziegler mitkuratiert worden.
Der Volksmund dagegen spottete über die pedantische Genauigkeit, mit der der schlagartig zum prominentesten deutschen Nacktmaler avancierte Kunstkammerpräsident biologische Details in Szene zu setzen wusste - und verpasste ihm den Spitznamen "Meister des deutschen Schamhaars".
"Bis zum Äussersten"
Doch auch Zieglers Ruhm hielt nicht lange. 1943 stellte er zum letzten Mal im Haus der Deutschen Kunst in München aus. Wegen "Beteiligung an Friedensbestrebungen", bei denen er und sein Bildhauerkollege Arnold Rechberg offenbar Kontakte zum britischen Premier Churchill nutzen wollten, verlor er seine Ämter und wurde für sechs Wochen im KZ Dachau inhaftiert. Doch selbst hier hatte Hitler womöglich seine schützende Hand über ihn gehalten, denn Ziegler kam glimpflich davon: 1944 wurde er - auf persönliche Weisung des "Führers" - ohne weitere Untersuchungen in den Ruhestand versetzt.
Der Umstand, dass seine Karriere so unerwartet endete, sollte ihm schließlich bei der Entnazifizierung von Nutzen sein: Wieder kam ihm sein Schwiegervater Albert Pietzsch zu Hilfe, der aussagte, Ziegler habe ihn dafür gewinnen wollen, "den Weltkrieg zu beenden".
Der Hannoveraner Entnazifierungs-Hauptausschuss stufte den hohen NS-Funktionsträger schließlich wegen seiner Beziehungen zu Rechberg und weil er "wiederholtes tolerantes Verhalten gegenüber rassisch verfolgten Künstlern" gezeigt habe, von der Kategorie "Hauptschuldiger" zum "Mitläufer" herunter. Ziegler selbst gab sich während der Ermittlungen naiv bis weltfremd - oder extrem berechnend. Im Protokoll zu seiner Befragung bezüglich der Aktion "Entartete Kunst" heißt es: "Betroffener erklärt, er habe sich gewehrt bis zum Äussersten.">
========
6.8.2012: Die Autobahn-Legende
aus: n-tv online: 80 Jahre AutobahnVon wegen "Straßen des Führers"; 6.8.2012;
http://www.n-tv.de/panorama/Von-wegen-Strassen-des-Fuehrers-article6897856.html
<Noch lange nach dem Krieg galten die deutschen Autobahnen als die «Straßen des Führers». Der Diktator wollte den Autobahnbau erfunden haben, um Arbeitslose zu beschäftigen. In Wahrheit wurde die erste Autobahn schon 1932 eröffnet. Von jemand ganz anderem.Nicht alle Einfälle des passionierten Erfinders Konrad Adenauer haben sich durchgesetzt. So spricht heute niemand mehr von seinem beleuchteten Stopfei oder dem elektrischen Insektentöter. Doch mit ein wenig Wohlwollen kann man den ersten Bundeskanzler als Erfinder der Autobahn bezeichnen. Vor 80 Jahren, am 6. August 1932, eröffnete er als Kölner Oberbürgermeister die erste deutsche Autobahn, die heutige A 555. "So werden die Straßen der Zukunft aussehen", prophezeite er - und behielt recht.
Mit dem Bau der deutschen Autobahnen ist im öffentlichen Bewusstsein bis heute ein anderer Name verbunden. Dass Adolf Hitler auf diese Weise Hunderttausende Arbeitslose von der Straße geholt habe, ist vielleicht die langlebigste Nazi-Legende. Propagandaminister Joseph Goebbels pflegte zu behaupten, dass dem Führer die geniale Idee mit den Autobahnen schon während seiner Haftzeit nach dem misslungenen Putsch von 1923 gekommen sei. Da "schlug er die Karte unseres Vaterlandes auf seinen Knien auseinander und zeichnete in sie hinein seine Reichsautobahnen". In Wahrheit waren die Nazis bis zur Machtübernahme ausgesprochene Autobahn-Gegner. So wie die meisten Parteien. In der Weimarer Republik war es nahezu Konsens, dass reine Autostraßen als purer Luxus für die oberen Zehntausend zu betrachten seien. Für normale Leute war ein Automobil schließlich unerschwinglich. Wieso sollte der Staat da hingehen und Unsummen für ein Straßennetz verpulvern? Man konnte schließlich Bahn fahren.
"Jeben Se Jas!"
Oberbürgermeister Adenauer sah es anders. Erstens hatte er ein Faible für schnelle Autos - später als Kanzler spornte er seinen Chauffeur immer wieder mit den Worten an: "Jeben Se Jas!" (Geben Sie Gas) - und zum zweiten war zwischen Köln und Bonn wirklich die Hölle los. Die alte Landstraße zwischen den beiden rheinischen Städten galt als die am stärksten befahrene des ganzen Deutschen Reiches - regelmäßig gab es Tote. Deshalb regte Adenauer eine "Nur-Autostraße" an, auf der Fußgänger und Radler ebenso verboten sein sollten wie das "Treiben und Führen von Tieren".
Die Realisierung des Projekts wurde paradoxerweise durch die Weltwirtschaftskrise begünstigt. Als die Arbeitslosigkeit immer weiter stieg, ließen sich die rheinische Provinzialregierung und die Reichsregierung in Berlin dazu bewegen, den Bau der Köln-Bonner-Autobahn als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zu bezuschussen. 5500 Männer fanden vorübergehend Arbeit. So kam es, dass Adenauer "seine" Autobahn ausgerechnet auf dem Höhepunkt der Krise eröffnen konnte.
Die örtliche Presse bejubelte die "breite, mit grauschwarzem Splitt bedeckte Straße", die schon fast so aussah wie eine heutige Autobahn. Das Einzige, was fehlte, war die Mittelleitplanke - stattdessen gab es nur einen dicken Streifen zur optischen Abtrennung. Das führte dazu, dass bald auf der Gegenfahrbahn überholt wurde.
NS-Propagandalüge
Schon im nächsten Jahr wurde Adenauers Autobahn von den Nazis zur Landstraße herabgestuft, damit sich Hitler als Erfinder der Autobahn profilieren konnte. Der Führer - der übrigens nie einen Führerschein besaß - überwand dafür sogar seine Abneigung gegen jede Form von körperlicher Anstrengung und tat am 23. September 1933 vor einem Pulk von Fotografen selbst ein paar Spatenstiche. Generalinspektor Fritz Todt verkündete: "Wir gehen nicht mehr stempeln, sondern wir bauen Straßen."
Die Bevölkerung glaubte dies nur zu gern, da die Arbeitslosigkeit nun tatsächlich sprunghaft abnahm. Das hatte allerdings nur zu einem geringen Teil mit den Autobahnen zu tun. Historiker führen Hitlers Beschäftigungswunder heute vor allem auf die staatlichen Rüstungsprogramme und das Anziehen der Weltkonjunktur zurück. Die Reichsautobahnen blieben unter Hitler immer nur Teilstücke. Ein zusammenhängendes Autobahnnetz entstand erst, als Adenauer erneut regierte - diesmal allerdings nicht in Köln, sondern am anderen Ende seiner Autobahn: in Bonn.
Quelle: n-tv.de, dpa>
========
26.10.2012: Kampf um einen alliierten Piloten auf einer dänischen Insel
aus: Spiegel online: Weltkriegsdrama auf Samsø: Die Insel der Mutigen; 26.10.2012;
http://einestages.spiegel.de/s/tb/25747/samsoe-im-zweiten-weltkrieg-versteck-fuer-juden-und-alliierte.html
<Im Zweiten Weltkrieg war Samsø von deutschen Truppen besetzt. Als im Oktober 1943 ein alliiertes Flugzeug über der dänischen Insel abstürzte, suchte die Gestapo nach den Piloten und stieß auf ungeahnten Widerstand - darunter ein Wehrmachtsoldat, für den Menschlichkeit mehr zählte als jeder Befehl.
Von Till Mayer
Der Krieg kommt am 9. Oktober 1943 mit einem riesigen Donnerschlag nach Samsø. Diesmal stürzt die Maschine nicht ins Meer wie andere alliierte Bomber, die von deutschen Jägern vom Himmel geholt werden. Der Rumpf der B-17 rast über die Wiesen der Insel, reißt ein ganzes Haus mit sich. Dann kommt die fliegende Festung zum Stehen. Der Stahl ächzt ein letztes Mal, die Propeller der vier Motoren wirken wie skurril verdrehte Kunstwerke. Die kleine Fachwerk-Kate, die in der Landeschneise liegt, brennt lichterloh. Ihre Bewohnerin hat Glück im Unglück: Die alte Witwe ist bei Nachbarn zu Besuch.
Der Absturz kommt für Samsø, die kleine Insel mit den verschlafenen Dörfern, reetgedeckten Häusern und einsamen Bauernhöfen, zu einem denkbar gefährlichen Moment. Vor allem für eine Handvoll Juden aus Deutschland, die auf ihre Flucht nach Schweden warten. Seit 1941 haben die Männer Schesinger, Grünspan, Bernfeld, Kassup und Fischl bei Bauern auf der Insel Unterschlupf gefunden. Bis zum 1. Oktober 1943 sind die Zwölf legal im besetzten Dänemark.
Als Inselpolizist Anton Porse mit seinem kleinen Dienstwagen über die holprige Landstraße Richtung Absturzstelle knattert, befürchtet er Schlimmes. Der Bomber wird viele auf der Insel in Gefahr bringen, ahnt er. Nur wenige Kilometer entfernt ist ein Dutzend deutscher Wehrmachtsoldaten auf einer Anhöhe stationiert. Ein Beobachtungsposten mit Hochleistungsfernglas, Baracke und einem in Meerrichtung gebauten, selbstgemauerten Plumpsklo. Letzteres bietet vermutlich einen der friedlichsten Ausblicke des Zweiten Weltkriegs, den sich 1943 ein Landser ergattern kann.
Doch es ist nicht der Trupp Wehrmachtsoldaten, der dem dänischen Ordnungshüter Kopfzerbrechen bereitet. Man kennt sich. Der kommandierende Offizier Otto Tretow ist ein Mann, der lieber heute als morgen seine Uniform ausziehen würde, damit er wieder hinter dem Pflug auf seinen Feldern nahe Danzig marschieren kann. Porse erreicht die Absturzstelle, kurz darauf schaukeln die Landser auf einem Pritschenlaster herbei und stehen ratlos vor dem Wrack. Nur der Leichnam des Bordschützen liegt in den Trümmern, von der Besatzung fehlt jede Spur.
Porse weiß, was das bedeutet. Fremde Wehrmachtsoldaten, SS oder Gestapo werden nicht lange auf sich warten lassen.
Doch die Nazis haben schon ihre Vernichtungsmaschinerie angeworfen. Die Deportationen in die Konzentrationslager beginnen. Dem Großteil der dänischen Juden gelingt dank einer Vorwarnung des deutschen Diplomaten Georg Ferdinand Duckwitz und mit Unterstützung von Widerstandsgruppen und vielen mutigen Dänen die Flucht ins neutrale Nachbarland Schweden. Auch den deutschen Juden von Samsø.
Doch als die Deutschen nach der alliierten Flugzeug-Crew suchen, befinden sich noch immer einige der jüdischen Flüchtlinge aus dem "Reich" auf der Insel, die noch nicht nach Schweden fliehen konnten. Ihnen Unterschlupf zu gewähren ist nun eine Straftat. Und so gut wie jeder der 6000 Bewohner der Insel weiß, auf welchen Höfen sie leben.
"Ich hatte furchtbare Angst"
Auch der junge Bruno hat es noch nicht nach Schweden geschafft. Irgendwie scheint ihm der Ernst der Lage aber nicht klar zu sein. Ausgerechnet die Absturzstelle will der neugierige deutsche Jude sehen. Dort, wo nun die Gestapo schnüffelt, alles voller Soldaten ist. Polizist Porse muss der Kragen geplatzt sein, als er ihn auf den Weg dorthin abfängt. Das erzählt Ole Pedersen.
Der pensionierte Lehrer lebt seit Jahrzehnten auf Samsø und geht oft mit seinem Freund Bertel Madsen auf Zeitreise. Dann stöbern sie im kommunalen Archiv in den alten Bänden der Lokalzeitung "Samsø Posten", interviewen Zeitzeugen. Pedersen hat mittlerweile ein Buch über die Kriegszeit auf Samsø geschrieben.
Bertel Madsen kam 1934 als Sohn einer alteingesessenen Bauernfamilie auf der Insel auf die Welt. Er kann sich noch an Bruno und die deutschen Juden erinnern: "Das waren alles gebildete Leute aus der Großstadt. Auf den Feldern haben sie sich nicht sehr geschickt angestellt. Aber sie gaben ihr Bestes", erzählt er augenzwinkernd. Vor allem erinnert er sich an das Plakat, das plötzlich wenige Tage nach dem Absturz nahe dem Hof seiner Eltern hängt. Als er den Adler mit dem Hakenkreuz sieht, ahnt der Junge Übles. "Da stand geschrieben: Wenn nicht umgehend alle Besatzungsmitglieder der abgestürzten Maschine ausgeliefert werden, kommt es zur Geiselnahme durch die Deutschen", erinnert sich Madsen.
"Ich hatte furchtbare Angst, als ich das gelesen habe. Und ich denke, eigentlich ging es wohl jedem so auf Samsø", sagt Bertel Madsen, der damals gerade neun Jahre alt war. Doch die Insulaner lassen sich nicht einschüchtern, sie halten dicht. Sie verraten weder die Bomber-Crew noch die Juden, die auf ihrer Insel sind. Die ersten Flüchtigen der Besatzung waren zwar schnell gefasst worden, aber fünf können die mutigen Bauern über viele Tage hinweg vor der deutschen Geheimpolizei verstecken.
Ein Holzsarg vor der Tür
Der Inselpolizist Porse beschwichtigt die Besatzer derweil, wo er nur kann. Darin hat er Erfahrung. So hat er schon den führenden Kommunisten der Insel gerettet, als dieser verhaftet werden sollte. "Lasst ihn gehen, der ist nicht gerade clever und harmlos, hat Porse den Nazis erzählt", sagt Pedersen und lacht.
Schließlich nehmen die Deutschen die feindlichen Flieger doch noch gefangen - aber ohne brauchbare Hilfe aus der Bevölkerung. Einen Piloten ziehen sie aus einem Hühnerstall, das nächste Crew-Mitglied finden sie im Wald. Den letzten entdecken sie schließlich im kleinen Krankenhaus. "Der war mit Verbandsmaterial verpackt wie eine Mumie", grinst Madsen über den letzten Versuch der Samsøer, einen der Alliierten zu verstecken.
Nur eine Familie gerät in Verdacht, einen Hinweis an die Besatzer gegeben zu haben. "Am nächsten Tag stand ein kleiner schwarzer Holzsarg vor ihrer Haustüre. Die Familie wurde lange Zeit schikaniert. Dabei hatten sie vermutlich nichts gesagt." Juden sucht die Gestapo danach keine mehr auf der Insel. "Vermutlich haben sie geglaubt, alle wären schon in Schweden", sagt Pedersen. Doch ein Wort von Wehrmachtsoffizier Tretow, und Bruno hätte seinen Weg in ein Konzentrationslager antreten müssen. "Tretow wusste natürlich nur allzu gut, dass Bruno und andere Juden noch auf der Insel waren", sagt Pedersen.
Der Vorfall mit dem Bomber hat Bruno gezeigt, dass er Dänemark schnell den Rücken kehren muss. Er verlässt vermutlich als letzter der deutschen Juden die Insel und schafft es, sich nach Schweden abzusetzen. Doch der Abschied von Samsø fällt ihm schwerer als den anderen jüdischen Flüchtlingen. Er hat mit Esther, einem jungen Bauernmädchen, ein Kind gezeugt. "Meine Familie war traurig, als Bruno gehen musste. Daran kann ich mich noch erinnern. Und dass er immer wie verrückt nach Eigelb war", sagt Marie Elisabeth Sander Petersen, die mit dem jüdischen Jungen damals unter einem Dach lebte.
Tretows schwerer Weg
Polizist Porse muss 1943 aufgeatmet haben, als die letzten Juden in Sicherheit waren. Doch der Gestapo scheinen die Insulaner mittlerweile verdächtig geworden zu sein. Ein vermeintlich dummer Kommunist, Bauern, die deutsche Juden aufnehmen und alliierte Flieger verstecken, ein Polizist der herumdruckst, 6000 Menschen, die nicht kooperieren. "Plötzlich tauchte ein Däne auf der Insel auf, stellte eigenartige Fragen", berichtet Ole Pedersen. Die Widerstandsgruppe reagiert. Der Spion wird ebenfalls versteckt: kopfüber im Moor.
Er hätte viel zu berichten gehabt. Von Offizier Tretow zum Beispiel, der mehr und mehr den Widerstand deckt. "Leuchtturmwärter Mönsted gab ihm Hinweise, dann wusste der deutsche Offizier, dass die Alliierten Waffen abwerfen. Tretow hat dann selber den Nachtdienst übernommen, um die Operation zu schützen", erzählt Ole Petersen.
Der Beamte Porse muss sich schließlich selber noch in den Wäldern von Samsø verbergen. Die deutsche Besatzungsmacht löst die dänische Polizei am 19. September 1944 wegen mangelnder Kooperation auf und interniert viele der Beamten. Bis Porse aufs Festland flieht, wird er von der Herrin des Guts Brattingsborg versorgt. Am 8. Mai 1945 endet der Krieg auf Samsø.
Die Insulaner bieten Tretow danach einen Hof zur Pacht an. Er lehnt ab. Zu seinem eigenen Grund nahe Danzig kann der Wehrmachtsoffizier jedoch nicht mehr zurückkehren. Sein ganzes Dorf ist vertrieben. Der Mittfünfziger Tretow muss noch Furchtbares erlebt haben. "Meines Wissens hat er den Freitod gewählt", sagt Ole Pedersen. Bruno und Esther werden kein Paar. Beide gründen eigene Familien, bleiben aber in Kontakt.
Die Insulaner haben bis heute ein funktionierendes System, das vor Einsätzen von Ordnungsmächten warnt. Auch wenn es nur noch anstehende Kontrollen der Verkehrspolizei vom Festland sind, die sich auf der Insel herumsprechen.>
=====
22.11.2012: Hitler verbot bei Länderspielen Niederlagen
aus: Welt online: Kolumne "Abseits": Länderspiele im Krieg - Hitler verbot Niederlagen; 22.11.2012;
http://www.welt.de/sport/fussball/article111322347/Laenderspiele-im-Krieg-Hitler-verbot-Niederlagen.html
<Vor 70 Jahren fand das letzte Länderspiel unter NS-Herrschaft statt. In den 35 Partien seit Kriegsausbruch galt es, der Welt die Überlegenheit der "Herrenrasse" auf allen Schlachtfeldern zu beweisen.
Von Udo Muras
Länderspiele sind zuweilen ein zweifelhaftes Vergnügen. Der torlose Klassiker gegen die Niederlande in der Vorwoche etwa dürfte schon bald in Vergessenheit geraten. Dennoch ist die Vorfreude stets aufs Neue groß, und niemand will auf sie verzichten, sonst hätte es wohl kaum schon über 860 Partien gegeben. Manchem wird schon die fast dreimonatige Pause zu lang sein, ehe es im Februar in Paris weitergeht.
Heute kaum vorstellbar ist jedoch die Zäsur, die sich vor 70 Jahren ergab: Acht Jahre lang wurden nach dem 22. November 1942 keine Länderspiele mehr ausgetragen. Das 5:2 in Pressburg gegen die Slowakei war der 100. Sieg der Historie des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), schon deshalb war es ein besonderes Spiel. Dass es das letzte Spiel im Krieg sein würde, mag mancher zwar geahnt haben angesichts der militärischen Lage. Fakt war es damals nicht.
Für das Frühjahr 1943 waren bereits vier Länderspieltermine abgeschlossen worden, natürlich nur mit befreundeten Nationen – von denen es damals nicht mehr viele gab. Spanien, Italien, Rumänien standen parat, auch ein Rückspiel gegen die Slowakei war vereinbart. Dann wohl in besserer Atmosphäre, wie Reichstrainer Sepp Herberger hoffte.
Er notierte nach dem letzten Spiel unter NS-Herrschaft, das im Zeichen politischer Proteste stand: "Das Publikum fanatisch und undiszipliniert. Der Schiedsrichter Bazant ein glatter Versager." In der Heimat wurden die Deutschen natürlich auch in der Sportpresse belogen. Die "Fußball-Woche" fabulierte, die Mannschaft "erhielt wie immer den allerherzlichsten Empfang". Die heile Welt fand 1942 in Wahrheit nur noch in den vom Propagandaministerium kontrollierten Medien statt – und der Sport, insbesondere der Volkssport Fußball, hatte gefälligst auch dazu beizutragen.
Wenn es auch rein sportlich um nichts ging in den 35 Partien seit Kriegsausbruch am 1. September 1939 – Turniere fanden keine statt – stand doch jedes Mal viel auf dem Spiel. Es galt, der Welt die Überlegenheit der "Herrenrasse" auf allen Schlachtfeldern zu beweisen. Verlieren war quasi verboten. Hin und wieder geschah es dennoch, schon das erste Spiel im Krieg endete mit einem 1:5 in Budapest. Herberger wusste, warum: "Diese drei Wochen Krieg hatten alle und alles, was an Leistungsvermögen vorhanden war, narkotisiert."
1:2 am Geburtstag des Führers
Die Nazis forderten trotzdem Erfolge. Im "Kicker" stand Ende 1942: "So ein Fußball-Länderspiel im Krieg wirbt und wirkt für das Reich mehr und tiefer im Volk des gastgebenden Landes als alle Komitees und Bücher." Dass die Elf ausgerechnet am Geburtstag von Führer Adolf Hitler 1941 in der Schweiz 1:2 verlor, sorgte dementsprechend für Verstimmung in Berlin.
"Es grenzte an Hochverrat und Majestätsbeleidigung", erinnerte sich Nationalspieler Helmut Schön, später Bundestrainer. Propagandachef Joseph Goebbels ließ den Sportminister antanzen und ausrichten, dass "kein Sportaustausch mehr gemacht werden soll, wenn das Ergebnis im Geringsten zweifelhaft ist".
Lieber sahen sie ein 13:0 gegen Sparringspartner wie Finnland. Aber auch die Nazis konnten nicht ändern, dass der Ball rollt, wohin er will. Und es war ihre Schuld dass ihre Spieler an der Front physische und psychische Kräfte ließen – und viele (insgesamt 48) sogar das Leben.
"100.000 gingen deprimiert heim"
Das galt für manchen Gegner nicht. Und so kamen etwa die Schweden im September 1942 in Berlin in ausgeruhtem Zustand zu einem 3:2-Sieg. Wieder tobte Goebbels: "100.000 sind deprimiert aus dem Stadion weggegangen; und da diesen Leuten ein Gewinn dieses Fußballspiels mehr am Herzen lag als die Einnahme irgendeiner Stadt im Osten, müsste man für die Stimmung im Inneren eine derartige Veranstaltung ablehnen."
Vier Monate später war es so weit, aber das lag nicht an den Schweden. Die Ereignisse in Stalingrad, wo die Reste der 6. Armee kapituliert hatten, führten zum "totalen Krieg". Da war für Sport kein Platz mehr; jedenfalls nicht, wenn die Sportler dafür mehr als 100 Kilometer reisen mussten. Erlaubt war nur noch der "nachbarliche Sportverkehr".
Einen Tag nach der berühmten Goebbels-Rede im Berliner Sportpalast verkündete Sportminister Hans von Tschammer und Osten: "Länderkämpfe, internationale Wettkämpfe sind bis auf Weiteres abzusetzen." Herberger unterstrich in seinen Notizen die Worte "bis auf Weiteres".
Heute erscheint vieles beinahe grotesk
Ihm ging es schon lange nicht mehr nur um Fußball. Die Spiele waren eine Chance, Leben zu retten. 1942 setzte er durch, dass vor jedem Länderspiel dreiwöchige Lehrgänge stattfanden. Damit holte er seine Spieler buchstäblich aus der Schusslinie. Noch Anfang 1943 versammelte er in Frankfurt 35 Spieler vor einem Test gegen Hessen-Nassau zu einem Lehrgang.
Aber auch in der Heimat war es nicht mehr sicher, schon 1940 verbrachten die Nationalspieler in Hamburg einige Stunden im Luftschutzkeller. Im Mai 1942 musste Herbergers Training in Wuppertal mehrmals unterbrochen werden – wegen Fliegeralarms.
Heute erscheint es da beinahe grotesk, dass Spieler wie Fritz Walter oder Helmut Schön auch positive Erinnerungen an diese Zeit hatten. Schön etwa schrieb in seinen Memoiren: "Trotz des sinnlosen Krieges war es für uns Sportler eine herrliche Fußballzeit. Für uns war mit jedem Länderspiel die verlockende Aussicht verbunden, über die Grenzen zu kommen. Es war immer ein extra Einkaufsnachmittag eingeplant. Auf zum nächsten Kaufhaus."
Einmal gab Herberger seinen Schützlingen sogar Spielgeld fürs Kasino. Auch das war nur eine kurze Flucht in eine scheinbar heile Welt.>
========
28.12.2012: Der "Brieftaubencode" ist immer noch nicht geknackt
aus: Spiegel online: Geheimbotschaft aus Weltkrieg Experten verzweifeln an Brieftauben-Code; 28.12.2012;
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/brieftaube-mit-geheimbotschaft-weltkrieg-code-doch-nicht-geknackt-a-874803.html
<"HVP" heißt "Have Panzers" - so leicht war die Geheimbotschaft einer toten britischen Brieftaube angeblich zu decodieren. Doch die vermeintliche Lösung ist zu simpel, um wahr zu sein. Die Nachricht aus dem Zweiten Weltkrieg bleibt unentschlüsselt.
Gord Young wollte es der Welt zeigen. Und für eine Weile sah es auch so aus, als habe der kanadische Historiker im Ruhestand das tatsächlich geschafft. Während sich Krypto-Experten rund um den Globus vergeblich darum mühten, eine chiffrierte Nachricht aus dem Zweiten Weltkrieg zu entschlüsseln, verkündete der Senior aus Peterborough in Ontario den Erfolg: "Truppen, Panzer, Geschütze, Pioniere, hier. Gegenmaßnahmen gegen Panzer funktionieren nicht" - so habe der Fallschirmspringer William Stott aus Frankreich berichtet, in Vorbereitung der D-Day-Offensive der Alliierten im Sommer 1944.
Eine Brieftaube hatte die Botschaft nach England bringen sollen - war aber bei der Rückreise ums Leben gekommen. Erst nach Jahrzehnten fanden sich ihre Überreste in einem Schornstein, wo der fliegende Kurier wohl steckengeblieben war. Mit der Entdeckung begann das Rätseln um den Weltkrieg-Code - weil längst die Hilfsmittel zur Entschlüsselung fehlten. Gord Young wollte die Nachricht schließlich mit Hilfe eines alten Militärhandbuches geknackt haben, binnen sagenhafter 17 Minuten. Auch SPIEGEL ONLINE vermeldete den Erfolg. Dumm nur: Die vermeintliche Sensation ist vermutlich gar keine.Michael Smith, ein historischer Berater des Codeknacker-Museums im legendären Bletchley Park, spart jedenfalls nicht mit abfälligen Äußerungen. Youngs Lösungsvorschlag sei "Nonsens" und "einfach albern", so Smith gegenüber der BBC. Seine auch im "Telegraph" geäußerte Kritik zielt vor allem auf das wichtigste Hilfsmittel ab, dass der Kanadier verwendet haben will: Das Militärhandbuch, einst von einem Verwandten im Feld genutzt, stammt nämlich aus dem Ersten Weltkrieg. Damit wäre es in den Vierzigern aber der deutschen Wehrmacht bekannt gewesen - und damit viel zu unsicher als Hilfsmittel.
Die handgeschriebene Nachricht besteht aus 27 Gruppen von jeweils fünf Buchstaben: "AOAKN", "HVPKD" und so weiter. Smith sagte, die Entschlüsselung von Young habe den Buchstaben eine direkte Bedeutung zugeordnet. So habe er "HVP" als "Have Panzers" decodiert - "Haben Panzer". Eine denkbar simple Erklärung - und wahrscheinlich eben zu simpel.
Die Krypto-Profis vom britischen Geheimdienst GCHQ ("Government Communications Headquarters") hatten bereits einen Tag nach den Schlagzeilen um Young eine ausgesprochen zurückhaltende Pressemitteilung veröffentlicht. Man habe die Medienberichte "mit Interesse" verfolgt. Von den mehreren hundert bisher präsentierten Lösungsvorschlägen habe die Experten aber keiner überzeugt.
Der GCHQ hatte zuvor erklärt, dass zur Verschlüsselung des Textes möglicherweise ein sogenanntes One-Time-Pad (OTP) benutzt wurde. Das ist ein Codierverfahren, das - mathematisch nachweisbar - nicht zu knacken ist. Zumindest, wenn man es richtig verwendet.In der Praxis kommt es aber eher selten zum Einsatz: Der nötige Schlüssel muss mindestens so lang sein wie der zu verschlüsselnde Text. Auf jeden Buchstaben des Ausgangstextes wird dann einmal der entsprechende Buchstabe des Schlüssels angewendet - und fertig ist der Code. Allerdings kann der Schlüssel, der Name legt es nahe, nur einmal eingesetzt werden. Und wenn der Schlüssel vernichtet wurde, gibt es keine echte Chance zur Entschlüsselung.
Und genau danach sieht es derzeit aus.
chs>
========
3.1.2013: Kriegsschuld-Diskussion: Roosevelt (Rosenfelt) gegen Goebbels 1943
aus: Welt online: Zweiter Weltkrieg: Goebbels' Propagandaschlacht gegen Roosevelt; 3.1.2013;
http://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article112273385/Goebbels-Propagandaschlacht-gegen-Roosevelt.html
<In einem Pressegespräch am Neujahrstag des Jahres 1943 wies US-Präsident Roosevelt Hitler alle Kriegsschuld zu. Goebbels hielt mit allen Mitteln dagegen. Aber seine Kampagne verfing nicht mehr.
Von Sven Felix Kellerhoff
Zuversicht ist eine mächtige Waffe – das wusste Franklin D. Roosevelt. Deshalb begann der US-Präsident am 1. Januar 1943 das neue Jahr ganz bewusst mit einem scheinbar unzeitgemäßen Appell. In einem 35 Minuten kurzen Gespräch mit einigen Journalisten im Oval Office des Weißen Hauses verkündete das mit schon fast einem Jahrzehnt im Amt erfahrenste Staatsoberhaupt der USA: "Die wichtigste Aufgabe der Zukunft ist es, den Frieden zu erhalten."
Nicht einmal 13 Monate nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor war das eine durchaus überraschende Aussage für den obersten Befehlshaber der wichtigsten kriegsführenden Macht. Zwar hatte die US-Navy im zweiten Halbjahr 1942 große Erfolge im Pazifikkrieg errungen, zwar waren in Nordafrika die ersten US-Soldaten auf dem (erweitert gedachten) europäischen Kriegsschauplatz gelandet: Doch noch beherrschten die Verbündeten Hitler-Deutschland und Japan fast den gesamten europäischen Kontinent und den westlichen Pazifik.
Doch Roosevelt machte sich in dem Pressegespräch vor allem Gedanken über die Zukunft der Welt nach dem Sieg über seine Gegner. Zu den wichtigsten Aufgaben aller, besonders der Männer an den Fronten zu Lande und zur See, gehöre, dass nach dem gegenwärtigen Krieg die Welt nie wieder durch ein ähnliches "Fegefeuer" gehen müsse. "Alle unsere Pläne für die Zukunft zielen auf Frieden", sagte der Präsident.
Goebbels redete sich die Lage schön
Mehr mit der blutigen Gegenwart beschäftigte sich eine Erklärung der US-Regierung über die Hintergründe des Krieges, die Roosevelt parallel mit dem Termin im Oval Office herausgeben ließ. Eindeutig wies der Präsident darin die Schuld für den Krieg und das bereits millionenfache Sterben Adolf Hitler und seinem Expansionsstreben zu.
Am 2. Januar 1943 berichteten US-Zeitungen über diese klare Stellungnahme, einen Tag später auch Blätter neutraler Staaten wie der Schweiz und Schweden. Auf diese Weise kam der Wortlaut der Erklärung in Berlin an – und brachte Propagandaminister Joseph Goebbels zum Schäumen: "Roosevelt hat ein Weißbuch über die angebliche Kriegsschuld der Achsenmächte herausgegeben. In diesem Weißbuch werden alle Tatsachen glatt auf den Kopf gestellt." Das diktierte er am frühen Morgen des 4. Januar 1943 seinem Sekretär für seine täglichen Aufzeichnungen.
Hitlers Chefpropagandist redete sich die Lage schön: "Warum Roosevelt das Weißbuch herausgegeben hat, ist ganz klar: Er wird bei zunehmenden Schwierigkeiten der amerikanischen Kriegführung mehr und mehr für diesen Krieg verantwortlich gemacht und sucht sich jetzt ein Alibi zu verschaffen." Goebbels wies die deutsche Propaganda an, "in schärfster Weise" gegen die Erklärung zu polemisieren. Den Vorschlag des Auswärtigen Amtes, es totzuschweigen, hielt der Minister "für durchaus unrichtig".
"Roosevelts gemeinster Fälschungsversuch"
Mehrere Tage lang beschäftigte sich daraufhin die gesamte deutsche Presse, vom überregionalen NSDAP-Parteiorgan "Völkischer Beobachter" bis zu Lokalblättern in den letzten Provinzen, mit den Vorwürfen aus Washington. Unzählige oft ähnliche Artikel erschienen in vielen Hundert Zeitungen, unter eindeutigen Überschriften wie "Der Wahnsinnige vom Weißen Haus möchte sich von der Blutschuld reinwaschen" oder "Roosevelts gemeinster Fälschungsversuch" oder dem Versprechen "Granitene Tatsachen gegen freche Lügen".
Bei der Bevölkerung wirkten die Attacken allerdings kontraproduktiv, wie der SD, der Inlandsgeheimdienst des Reichssicherheitshauptamtes, am 7. Januar 1943 kaum verklausuliert in seinen "Meldungen aus dem Reich" feststellte: "Die Stimmen zur Polemik gegen das Weißbuch Roosevelts gehen überall weit auseinander." Zwar werde zum Teil "eingesehen", dass die deutsche Propaganda ausführlich und scharf dagegen auftreten müsste. In der Kriegsschuldfrage dürfte keinerlei Verwirrung der Tatsachen aufkommen.
Andererseits meldeten die Gestapo-Spitzel auch: "Es werde zum Teil nicht verstanden, dass nur die angreifbaren Punkte des Weißbuches veröffentlicht werden." So bekäme man kein klares Bild "vom Kern der Sache". Meistens brächten die Zeitungen nicht einmal wörtliche Zitate, sondern nur Auszüge in indirekter Rede. Für die überwiegend nur sehr einseitig informierte Bevölkerung waren das erstaunlich offene, kritische Ansichten.
Die Leser blätterten einfach weiter
Dennoch ließ Goebbels die gleichgeschalteten Redakteure weitere Angriffe auf den US-Präsidenten reiten. Allerdings registrierte die Gestapo, dass Artikel mit Überschriften wie "Skandal um Roosevelts Australienminister – ein Gangster deckt den anderen", über die "Rüstungshyänen in Roosevelts Schieberparadies" oder "Roosevelt – Marionette eines Juden" von den Lesern "mehr oder weniger überschlagen" würden.
Eigens kritisch vermerkten die SD-Agenten Reaktionen zu einem Artikel des "Völkischen Beobachters" mit der Überschrift "USA wollen erste Weltmacht werden". Über diesen Text würde in der Bevölkerung "bestenfalls lakonisch geäußert: ,Wozu darüber herumstreiten? Wenn der Krieg entschieden ist, dann wird sich ja zeigen, wer die Weltherrschaft hat und wer nicht'."
Als diese Ausgabe der "Meldungen aus dem Reich" gerade in Berlin zusammengestellt wurde, befand sich Franklin D. Roosevelt schon seit Tagen auf der anstrengenden Reise von Washington D.C. nach Casablanca. Dort traf er mit dem britischen Premier Winston Churchill zusammen, um in einer zehntägigen Konferenz in der zweiten Januarhälfte das wichtigste Kriegsziel der Alliierten festzulegen: die bedingungslose Kapitulation Hitler-Deutschlands, die den Frieden für die Zukunft sichern sollte.>
========
28.1.2013: NS-Anatomie im Dritten Reich an erschossenen Sträflingen
aus: Der Standard online: Die 182 Leichen des Dr. Stieve; 28.1.2013;
http://derstandard.at/1358304935403/Die-182-Leichen-des-Dr-Stieve
<Der NS-Anatom Hermann Stieve beanspruchte Exekutionsopfer für seine Untersuchungen. Die oben abgebildete Liste aus Jena 1943 gibt Auskunft über die Todesursache der aufgeführten Menschen - rot unterstrichen sind Hingerichtete.
Studie rekonstruiert Namen von NS-Anatomie-Opfern - Anatom nahm Einfluss auf den Zeitpunkt der Hinrichtungen
Ann Arbor / Wien - Liane Berkowitz war eine von ihnen. Die gerade einmal 19-Jährige wurde 1942 von der Gestapo verhaftet, als sie Plakate gegen die Nazi-Propaganda affichierte. Da Berkowitz schwanger war, wurde mit der Hinrichtung bis nach der Geburt ihres Babys zugewartet.Doch damit war die tragische Geschichte der Widerstandskämpferin noch nicht zu Ende. Berkowitz' Leiche gehörte zu den sterblichen Überresten von 182 vorwiegend weiblichen Exekutionsopfern, die der NS-Anatom Hermann Stieve für seine Untersuchungen beanspruchte. Der Anatom wollte unter anderem untersuchen, ob Schockerlebnisse in kurzer Zeit einen vom Zyklus abweichenden Eisprung auslösen können. Und dafür dürfte er von den Frauen auch verlangt haben, dass sie vor der Exekution einen Monatskalender führten.
Die höchst fragwürdigen Studien des Professors der Friedrich-Wilhelm-Universität Berlin (heute Humboldt-Uni) sind bereits recht gut erforscht. Doch relativ wenig ist bisher über seine Opfer bekannt, an denen er nach ihrer Exekution forschte. Diesen 174 Frauen und acht Männer - die meisten aus politischen Gründen hingerichtet - nahm sich nun die deutsch-amerikanische Anatomin und Medizinhistorikerin Sabine Hildebrandt im Fachblatt "Clinical Anatomy" an.
Stieve habe diese Liste erst 1946 erstellt, berichtet Hildebrandt. Und erst dank dieser Aufzeichnungen sei es möglich geworden, den Opfern wie Liane Berkowitz auf die Spur zu kommen, ihre Lebensgeschichte und ihr schreckliches Ende zu rekonstruieren. Stieve selbst hingegen sprach allenthalben von seinem "Material", das ihm "in der Zeit der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft überwiesen" worden sei.
Offensichtlich ist, dass Stieve sehr wohl Einfluss auf den Zeitpunkt der Hinrichtungen nahm, um an den weiblichen Leichen möglichst zeitnah seine anatomischen Studien durchführen zu können. Dabei setzte er sich oft genug gegen den letzten Willen der Hingerichteten hinweg: So etwa äußerte die Widerstandskämpferin Libertas Schultze-Boyen als letzten Wunsch, dass ihre "materielle Substanz" an ihre Mutter gehen und in der Natur begraben werden solle.
Wie Hildebrandts Recherchen bestätigten, erhielten sämtliche 31 Anatomie-Institute in Deutschland und den besetzten Gebieten Leichen von Exekutionsopfern. Besonders gierig war man in Wien: Für Eduard Pernkopfs Anatomieatlas wurden die Leichen von 1377 Hingerichteten ans Institut geliefert.
Stieve übrigens war bis zu seinem Tod 1952 unbehelligt Professor in Ostberlin. Im offiziellen Nachruf des SED-Zentralorgans "Neues Deutschland" hieß es: "Groß waren seine Taten. In seinem Werk wird er weiterleben." (tasch, DER STANDARD, 29.1.2013)
Abstract
Clinical Anatomy: The women on stieve's list: Victims of national socialism whose bodies were used for anatomical research>========
13.2.2013: Pfarrer Hoff gestand in den 1960er Jahren seine Beteiligung an Judenmorden in Weissrussland 1941-1942 - und huldigte der Beseitigung des Judentums in Deutschland 1943 - und durfte ab 1957 weiterarbeiten
aus: Spiegel online: Kirche und Kriegsverbrechen Der Sündenfall des Nazi-Pfarrers; 13.2.2013;
http://einestages.spiegel.de/s/tb/27561/kirche-und-kriegsverbrechen-der-suendenfall-des-pfarrers-walter-hoff.html
<Beichte ohne Folgen: Ende der sechziger Jahre verdächtigten Ermittler einen Pastor, an der Ermordung Hunderter Juden beteiligt gewesen zu sein. Bewiesen werden konnte ihm die Tat nicht. Nun kam heraus, dass der Kirche sogar ein Geständnis vorlag - und er dennoch als Geistlicher arbeiten durfte.
Der im Kyrillischen als Gof notierte Name, so wussten die Übersetzer, konnte auch Hof bedeuten. Oder auch: Hoff. Ein Walter Hoff, so fanden die Ermittler heraus, war 1941/1942 in der Gegend von Klimowitschi in der Leitung der Feldkommandantur 549. Er gehörte zu einer der Sicherungsdivisionen, die eigens für den Russlandfeldzug aufgestellt worden waren. Ihre Aufgabe war es, der nach Osten vorrückenden Front den Rücken freizuhalten, etwa durch die Bekämpfung von Partisanengruppen. Als Offizier einer Feldkommandantur in der Sicherungsdivision 221 brachten ihn die Ludwigsburger so Ende der sechziger Jahre auch in Verbindung mit Massenerschießungen von Juden durch ein Einsatzkommando der Sicherheitspolizei und des SD, dem Sicherheitsdienst der SS, in der Gegend von Klimowitschi.
Von Dagmar Pöpping und Solveig Grothe
[Ein Halbsatz in einem Brief von 1943]
Der bemerkenswerte Halbsatz stand in einem Brief, im vierten Absatz. Der Probst zu Berlin, Konsistorialrat Dr. Walter Hoff, hatte seinem Berliner Amtskollegen Oberkonsistorialrat Fichtner am 29. September 1943 mitgeteilt, dass er "in Sowjetrussland eine erhebliche Anzahl von Juden, nämlich viele Hunderte, habe liquidieren helfen".
Der damals 53 Jahre alte Pastor Hoff, gebürtiger Ostpreuße und Sohn eines Försters aus der Provinz Posen, diente als Hauptmann der Wehrmacht an der Ostfront. Nach dem Krieg sollte er sich vor seinem Dienstherrn, der Evangelischen Kirche in Deutschland, für ebenjenen Satz rechtfertigen.
[Die Aursede einer "Loyalität zum NS-Staat" - Ausschluss und Rehabilitation 1957]
Hoff gab an, er habe die Morde nur erfunden, um die politischen Überwachungsstellen von seiner Loyalität zum NS-Staat zu überzeugen. Doch allein schon dieses Ansinnen genügte: Hoff wurde suspendiert - und kämpfte in den Folgejahren um seine Rehabilitation. Als es ihm endlich gelang, war er ein alter Mann. 1957 erhielt er seine geistlichen Vollmachten zurück, um die er gebeten hatte, weil er sich "seelisch außerordentlich bedrückt fühle, in dieser Art und Weise aus einem Beruf ausgeschlossen zu sein, den ich mit größter Begeisterung angestrebt und eifrig und opferbereit ausgeübt hatte".
[Die evangelische Kirche galt 1945 als einzige "moralisch intakte" Institution - und durfte sich selbst entnazifizieren]
70 Jahre später beschäftigt Pfarrer Hoffs Brief die evangelische Kirche erneut. Der Berliner Bischof Markus Dröge sprach in einer Predigt Ende Januar 2013 vom "Versagen" in der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verstrickungen seiner Kirche. Explizit erwähnte er Pfarrer Hoff. Seit etwa zehn Jahren dokumentiert die Kirche in selbstkritischer Absicht den Fall wissenschaftlich. Sie ließ in eigenen Archiven nachforschen und auch in der Zentralstelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg. Die 1958 gegründete Behörde hatte sich nach dem Ende der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse jener NS-Schreckenstaten angenommen, die bis dahin ungeahndet geblieben waren. Die Erkenntnisse werfen ein neues Licht auf den Fall Hoff - und auf die evangelische Kirche. Sie galt den Alliierten nach Kriegsende als die fast einzige Großinstitution, die in der Zeit des Nationalsozialismus moralisch intakt geblieben war. Das war auch der Grund, weshalb die Alliierten den Kirchen die Entnazifizierung von Pfarrern und kirchlichen Angestellten weitgehend selbst überlassen hatten.
"Feldkommandant Dr. Gof"" - übersetzt "Hoff" - in Klimowitschi in Weissrussland
Die Ludwigsburger Behörde stieß unterdessen auf die Aussagen von sowjetischen Zeugen in einem Bericht über die "Verbrechen der Deutschen in Tscherikow und Umgebung". Als einer der Hauptbeschuldigten wird darin ein gewisser "Dr. Gof" benannt, der von Dezember 1941 bis Februar 1943 Leiter der Feldkommandantur in Klimowitschi in Weißrussland gewesen und als solcher Erschießungen und Hinrichtungen von Sowjetbürgern geleitet haben soll.
Bewohner von Klimowitschi hatten ausgesagt, dass im Dezember 1941 unter der Leitung von "Feldkommandant Dr. Gof" drei Männer aus dem Dorf Rekta wegen antideutscher Tätigkeit erschossen worden seien und dass derselbe im Winter 1941/42 einen Mitarbeiter der Kreiszeitung im Dorf Zharki, einen Greis und einen Bürger als Partisanen habe aufhängen lassen.
[Juden sollen mit sowjetischen Partisanen sympathisiert haben - 786 Juden erschossen]
In einer Ereignismeldung aus dem Reichssicherheitshauptamt vom 19. Dezember 1941 heißt es: "Im Anschluss an eine durch die 221. Sicherheitsdivision in der Gegend von Klimowitsche durchgeführte Partisanenaktion (…) wurde die Überholung der Ortschaften Klimowitschi und Tscherikow erforderlich, da die Juden dieser Orte sich deutschfeindlich gezeigt und mit den Partisanen sympathisiert hatten. Insgesamt wurden 786 Juden beiderlei Geschlechts erschossen."
Der Verdacht, Hoff könne an den Massenerschießungen beteiligt gewesen sein, lag nahe, da die Einsatzkommandos eng mit den Feldkommandanturen der Sicherungsdivisionen zusammenarbeiteten. Der Führer des Einsatzkommandos, Otto Bradfisch, war 1961 und 1963 für die Erschießung von 15.000 Juden verurteilt worden, jedoch ohne dass man Details der Vorgänge in Klimowitschi und Tscherikow hatte aufklären und die konkret Beteiligten hatte benennen können.
[1977 Tod von Hoff - 1979 Ermittlungen eingestellt]
1979, zwei Jahre nach dem Tod Hoffs, wurden die Ermittlungen gegen ihn eingestellt. Sie wären anders verlaufen, wenn man in Ludwigsburg von dem Bekennerschreiben Hoffs aus dem Jahr 1943 gewusst hätte. Und von dem, was der evangelischen Kirche sonst noch über Hoff bekannt war.
[Zuerst in Rellingen in Schleswig-Holstein - ab 1930 in Berlin - er verteidigte den Nationalsozialismus rücksichtslos]
Für das Evangelische Konsistorium Berlin-Brandenburg jedenfalls war es Grund genug, noch im Herbst 1945 ein Disziplinarverfahren gegen Hoff einzuleiten mit dem Ziel, ihn aus dem Amt zu werfen. Der Brief und das angebliche Bekenntnis zum Massenmord spielten dabei noch keine Rolle. Eher die Tatsache, dass der Kirchenmann seit den frühen dreißiger Jahren keinen Zweifel an seiner nationalsozialistischen Gesinnung gelassen und diese rücksichtslos gegenüber jedermann vertreten hatte.
Nach Berlin gekommen war Hoff 1930. Zuvor hatte der Pastor acht Jahre lang in der schleswig-holsteinischen Gemeinde Rellingen gedient und sich dort unter anderem juristisch gegen die Behauptung zu wehren versucht, Vater eines unehelichen Kindes zu sein. Seine Bewerbung auf die vakante Pfarrstelle der Luisengemeinde in Berlin-Charlottenburg schließlich hatte Erfolg.
Goebbels "mutiger Geistlicher" - [Gottesdienste für die SA, Eintritt in die NSDAP, "Deutsche Christen", Strassenkämpfe, Konsistorialrat]
Rasch erwarb er sich dort besondere Anerkennung - die von Gauleiter Josef Goebbels, der ihn 1931 einen der "leider noch wenigen mutigen Geistlichen“ nannte. Zu diesem Zeitpunkt hatte Hoff bereits mehrere Gottesdienste für die SA gehalten. Ein Jahr später trat er in die NSDAP ein, engagierte sich in der antisemitischen "Glaubensbewegung Deutsche Christen" für die Gleichschaltung der evangelischen Kirche und beteiligte sich als SA-Standartenpfarrer an gewalttätigen Straßenkämpfen gegen Kommunisten in Berlin.
Schon bald hatte Hoff wegen seiner politischen Verdienste für die NS-Bewegung auf ein führendes kirchliches Amt gedrängt. Und es bekommen: Als Konsistorialrat der Mark Brandenburg war er nun in der Position, missliebigen Kollegen und Untergebenen mit politischer Verfolgung zu drohen, etwa wenn sie sich über die Gewaltmaßnahmen der SA empörten oder weil sie aus der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV) ausgetreten waren.
[Hoff bekommt nach 1945 Probleme bei der Wiederanstellung - es geht um Rentenansprüche]
Nach dem Krieg konnte man sich daran noch gut erinnern. Jemanden wie Hoff wollte das inzwischen neu gebildete Konsistorium nicht in seinen Reihen haben.
Und fast hätte sich das Problem von selbst erledigt: Statt nach Berlin zurückzukehren, bewarb sich Hoff als Pfarrer bei der Hamburgischen Landeskirche. Doch auch die wollte ihn nicht. Zudem scheiterte der Versuch, Hoff zu überreden, freiwillig auf ein Amt zu verzichten. Der dachte nicht daran, seine Rechte als Pfarrer und vor allem seine Rentenansprüche kampflos aufzugeben.
"Zwecklüge glaubhaft" - [der Halbsatz wird publik - dauerhaft arbeitsunfähig - ein Viertel des gesetzlichen Ruhegehalts]
Erst jetzt machte Oberkonsistorialrat Fichtner, der Empfänger von Hoffs denkwürdigem Brief aus dem Jahr 1943, das Schreiben innerhalb der Kirche publik. Im Februar 1948 eröffnete das Berliner Konsistorium das Disziplinarverfahren gegen Hoff. Er wurde beschuldigt, "dass er in Berlin und während seiner Verwendung im Felde seit dem Jahre 1934 kirchliche und andere Amtsträger unter politischen und kirchenpolitischen Gesichtspunkten angegriffen und verfolgt hat und außerdem gegen sonstige Personen in nicht entschuldbarer Weise vorgegangen ist". Das genügte für einen Rauswurf.
Bemerkenswerterweise hieß es in der Urteilsbegründung bezüglich Hoffs Bekenntnis zum Massenmord: "Gleichwohl hat die Disziplinarkammer zum Mindesten als glaubhaft unterstellt, dass jene Angaben über Judentötungen nicht den Tatsachen entsprechen, sondern eine politische Zwecklüge waren."
Trotz Dienstentlassung ließ man Gnade walten: Hoff hatte offenbar ebenso glaubhaft vermitteln können, dass er körperlich hinfällig und dauerhaft arbeitsunfähig sei. Dem Mann, dem es schon nach seiner Rückkehr aus dem Ersten Weltkrieg unter Verweis auf sein "Herz- und Nervenleiden" gelungen war, eine eilige Amtseinführung seiner Person zu erreichen, wurde nun wohlwollend ein Viertel seines gesetzlichen Ruhegehalts gewährt. Zunächst für drei Jahre; dann aber, da Hoff ein langes Leben beschieden sein sollte, immer wieder verlängert.
[Revision - Behauptung der Verurteilung von Judenliquidierungen 1942 - der Dank für die Beseitigung des Judentums 1943]
Doch das reichte ihm nicht. Hoff legte Berufung ein und behauptete nun sogar, dass er Judenliquidierungen bereits 1942 verurteilt habe. Der zuständige Senat des Disziplinarhofs der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) wusste es besser: Er zitierte den "Aufruf des Propstes von Berlin", den Hoff anlässlich des zehnjährigen Bestehens der NS-Diktatur am 30. Januar 1943 publiziert hatte, und in dem er die Berliner aufforderte, Gott für die Beseitigung des Judentums in Deutschland zu danken.
[75% des Gehalts wird Rente - Aushilfspfarrer ab 1957]
Als der mittlerweile 62-Jährige schließlich als "reuiger Sünder" bat, ihm zu verzeihen, und dabei erneut auf seinen nur noch kurzen Lebensabend verwies, hatte er Erfolg: Das Konsistorium beantragte beim Rat der EKD, Hoff die Amtsrechte zurückzugeben, der dies aber verweigerte. Fünf Jahre später war Hoff am Ziel: Durch eine neue Disziplinarordnung war die Ratszustimmung nicht mehr nötig. Die Berliner entschieden selbst zugunsten Hoffs. Er erhielt die üblichen 75 Prozent seines Gehalts als Rente und durfte sich ab 1957 aushilfsweise als Seelsorger im Krankenhaus Ginsterhof in Tötensen bei Hamburg betätigen.
87-jährig und wegen seiner Taten in Weißrussland unbehelligt starb Hoff im Oktober 1977.
[Wollte die Kirche selbst vertuschen und sich vor Kriegsverbrechen freihalten?]
Offen blieb, ob die Kirche sein Bekennerschreiben nicht hatte ernst nehmen wollen, weil sie fürchtete, mit den Kriegsverbrechen in Verbindung gebracht zu werden. Oder ob es für die kirchliche Führung schlicht unvorstellbar war, dass ein Pfarrer an der Ermordung der europäischen Juden teilgenommen hatte.
Die Autorin Dr. Dagmar Pöpping arbeitet als Historikerin in Berlin und München. Ihr wissenschaftlicher Aufsatz zum Thema mit dem Titel "Zwischen Kriegsverbrechen und Pfarramt. Walter Hoff und die evangelische Kirche" erscheint im März 2013 in der "Zeitschrift für Geschichtswissenschaft".>
========
7.4.2013: Drill, Gewalt und Psychoterror in der "Napola": <Elite-Internate im "Dritten Reich": Hitlers brutale Kaderschmieden>
aus: Spiegel online; 7.4.2013;
http://einestages.spiegel.de/s/tb/28264/napolas-im-dritten-reich-hitlers-brutale-kaderschmieden.html
<Gewalt als Erziehungsmaßnahme: Vor 80 Jahren wurden die ersten Napolas gegründet. Tausende Schüler besuchten die nationalsozialistischen Ausleseschulen. Neben militärischem Drill gehörten auch Brutalität und Psychoterror zum Alltag. Durch Lehrer - und Mitschüler.
So wurde Karasek einer von schätzungsweise 17.000 Jungmannen, so bezeichnete man die männlichen Ausleseschüler. Er war nicht der einzige, der später Bekanntheit erlangen sollte. Unter ihnen waren unter anderem der Schauspieler Hardy Krüger, die Journalisten Theo Sommer und Jörg-Andrees Elten oder der Grafiker Horst Janssen.
Von Thomas Fritz
Eine kleine unscheinbare Sporthalle, vier Kilometer außerhalb des oberschlesischen Örtchens Loben: Dichtgedrängt standen die 30 Jungen zusammen. Sie fröstelten, jedoch nicht vor Kälte, sondern vor Anspannung. Vor ihnen ragte eine drei Meter hohe Sprossenwand empor, davor lagen dünne Matten aus Leder. Nun sollten die Zehnjährigen ihren Mut beweisen und sich von der höchsten Sprosse hinunterstürzen.
Das war keine leichtsinnige Mutprobe unter Kindern, sondern Teil einer offiziellen Aufnahmeprüfung - an einer der Nationalpolitischen Erziehungsanstalten, im Volksmund Napolas genannt. Wer im "Dritten Reich" auf diesen Elite-Internaten aufgenommen werden wollte, durfte sich nach den schulischen und sportlichen Tests auch diesem Einführungsritual nicht verweigern - die körperliche Unversehrtheit war zweitrangig. Einer der zitternden Jungen, die an diesem Tag vor der Sprossenwand standen, war Hellmuth Karasek.
"Von den vielleicht dreißig Jungen, mit denen ich die Mutprobe teilte - erst sahen wir zu, wie die anderen hochkletterten, um dann mit ausgebreiteten Armen herunterzustürzen, dann kletterten wir selber dem Sturz entgegen, höher, als wir es uns doch zutrauen wollten -, haben sich mindestens vier ein Bein gebrochen und fast alle die Beine verstaucht. Die Matten, die uns nach dem Fall auffingen waren hart, das braune Leder, mit Werg gefüttert, federte kaum."
Diese Zeilen stammen aus den Erinnerungen des Autors und Literaturkritikers. Im Schuljahr 1944/45 besuchte er für einige Monate die Napola Loben im heutigen Polen.
Aus der behüteten Kindheit vertrieben
Karasek war in der Oberschule von Werbern des Nazi-Internats angesprochen worden. Er war ein aufgeweckter Schüler, außerdem waren Oma, Vater, Mutter und zwei Onkel NSDAP-Mitglieder, und sein Stammbaum laut NS-Ideologie "sauber" - das genügte für eine Einladung zu einer Probewoche, und nach bestandener Mutprobe sogar für die Aufnahme an das Internat. Dass er danach "tagelang stark humpelte", galt als Auszeichnung. Schließlich hatte sich Karasek erst durch das gefährliche Einführungsritual als würdiger Schüler erwiesen. "Ich hatte etwas erreicht, was ich gar nicht erreichen wollte", erinnerte sich mittlerweile 79-Jährige später. "Ich hatte mich selber aus meiner behüteten Kindheit, aus meiner Familie vertrieben."
Die Gründung der ersten drei Napolas war ein Geburtstagsgeschenk an Adolf Hitler. Sie wurden vom zukünftigen Reichserziehungsminister Bernhard Rust geplant und am 20. April 1933 eröffnet. Bis 1945 gab es reichsweit etwa 40 Napolas, drei davon für Mädchen. Hinzu kamen zwölf Adolf-Hitler-Schulen sowie die Reichsschule der NSDAP in Feldafing am Starnberger See. In all diesen Bildungseinrichtungen sollte in sechs- bis achtjähriger Ausbildung die kommende Führungsschicht des Nazi-Staates herangezogen werden.
Traum von der Karriere als Gauleiter in Moskau
Als Hardy Krüger 1941 nach fünf langen Auswahllehrgängen als 13-Jähriger in die Adolf-Hitler-Schule auf der Ordensburg Sonthofen aufgenommen wurde, war der Großteil seiner Familie "sehr stolz und glücklich". Der Junge selbst phantasierte gar schon von einer Karriere als "Gauleiter von Moskau". Aber im idyllisch gelegenen Sonthofen im Oberallgäu herrschten raue Sitten. Besonders Neulinge waren brutalen Schikanen ausgesetzt, das erlebte Krüger am eigenen Leibe.
"Nachts kamen die älteren Jahrgänge in unsere Stube, prügelten uns und schmierten uns mit Schuhwichse ein. Ich wehrte mich, so gut ich konnte. Einmal sogar mit dem Fahrtenmesser, was prompt zu einer Bestrafung vor der ganzen Schule führte."
Heute sind rund 40 biografische Schriften von NS-Ausleseschülern erhalten. Sie zeigen, dass Gewalt unter Schülern keine Ausnahme war. Diese wurde nicht nur vom Lehrkörper geduldet, sondern gehörte inoffiziell zum Lehrplan: Die Gemeinschaft, so ein Grundtenor der Internatserziehung, sollte sich selber erziehen. Wenn nötig mit rabiaten Methoden. Viele Lehrer und Erzieher ignorierten deshalb die Übergriffe, manche hießen sie sogar ausdrücklich gut.
Strafterror und Schläge mit Fäusten
An den Internaten wurde gefordert und gedrillt, die Schüler mussten sich ständig beweisen: Die Stuben hatten sauber zu sein, die Betten akkurat hergerichtet, die Kleidung musste im Spind "auf Kante" liegen, schulische und sportliche Höchstleistungen wurden erwartet. Die strengen Anstaltsregeln - Rauchen und Mädchen verboten - und der Ehrenkodex unter den Schülern - kein Diebstahl, kein Petzen, kein Abschreiben - waren penibel einzuhalten. Sonst folgten harte Sanktionen wie nächtlicher Strafterror, Schläge mit Fäusten, Linealen oder ausgewrungenen Handtüchern.
Die NS-Propaganda predigte außerdem unbarmherziges Verhalten gegen Minderheiten und Verhaltensauffällige - auch an den Internaten traf es die Schwächsten am härtesten.
"Am Abend, beim Appell, wurden die Bettnässer des Morgens bestraft. Vor versammelter Mannschaft bekamen sie einige Stockschläge auf das Gesäß, sie mussten sich vorbeugen, ein Kamerad die Strafe ausführen. Wir anderen sahen schweigend zu. Ich war weder gerührt noch erschreckt. Bettnässer, das war ich nicht. Und also empfand ich die allabendlichen Bestrafungen als gerecht. Aber eher war ich wohl abgestumpft."
Hellmuth Karasek erinnert sich, wie solche offiziellen Strafen zusätzliche Revanchegelüste unter den Schülern provozierten. Er sah darin ein "diabolisches System, bei dem die Strafe Aggressionen der Kameraden weckte, sie zur Vollstreckung durch nächtliche Stubenkeile aufstachelte." Später wunderte er sich darüber, dass ihm "so wenig, eigentlich so gut wie nichts" passiert war. Der Vormarsch der Roten Armee beendete Ende 1944 nach nur einem halben Jahr seine Napola-Laufbahn, im Alter von knapp elf Jahren. Es folgte eine Flucht-Odyssee, die ihn über die Zwischenstation Dresden und Bernburg (Saale) in den fünfziger Jahren nach Westdeutschland führte.
Hardy Krügers Schulzeit auf der NS-Eliteschule nahm eine sehr ungewöhnliche Wendung. Als er 1943 nach Babelsberg zum Dreh von "Junge Adler", seiner ersten Filmrolle, abkommandiert wurde, geriet er noch während seiner Internatszeit mit Regimegegnern in Berührung. Sie zeigten ihm verbotene Filme, klärten ihn über Konzentrationslager auf, spannten ihn schließlich für gelegentliche Botendienste ein. Krüger war in "ein gefährliches Doppelleben verstrickt". 1944 endete seine Schulzeit, als er mit 16 Jahren zur SS eingezogen wurde. Nur mit viel Glück überlebte er die besonders verlustreiche Endphase des Krieges und geriet in Süddeutschland in amerikanische Gefangenschaft.
Nach 1945 machten Karasek und Krüger Karriere, viele Jahre später verarbeiteten sie ihre Erlebnisse in Büchern. Eine Gnade, die vielen ihrer gefallenen oder traumatisierten Mitschüler versagt blieb. >
========
21.7.2013: Das "Reichskonkordat" mit dem Vatikan gilt bis heute (2013)
aus: Spiegel online: Vatikan und NS-Regierung Nichts hören, nichts sehen, vertragen; 21.7.2013;
http://einestages.spiegel.de/s/tb/29162/80-jahre-reichskonkordat-pakt-zwischen-vatikan-und-ns-regierung.html
<Das Abkommen bescherte Hitler seinen ersten großen außenpolitischen Erfolg: 1933 schlossen Papst Pius XI. und die NS-Regierung einen Vertrag, der die katholischen Angelegenheiten im Deutschen Reich regeln sollte. Der Vatikan machte weitreichende Zugeständnisse. Das sogenannte Reichskonkordat gilt bis heute.
Von René Schlott
Die Glocken des Petersdoms läuteten, als am Mittag des 20. Juli 1933 unter Anwesenheit eines Fotografen die feierliche Unterzeichnung des Vertrags zwischen dem Deutschen Reich und dem Heiligen Stuhl im Vatikanpalast erfolgte. Danach wurden Geschenke ausgetauscht: Der Verhandlungsführer des Reiches, Vizekanzler Franz von Papen, erhielt aus der Hand des Kardinalstaatssekretärs Eugenio Pacelli das Großkreuz des päpstlichen Pius-Ordens. Papen seinerseits überreichte Pacelli eine meterhohe Statue der Jungfrau Maria aus weißem Meißener Porzellan. Ministerialdirektor Bultmann vom Reichsinnenministerium erhielt eine Autogrammkarte des Papstes, der vatikanische Unterstaatssekretär Ottaviani im Gegenzug einen silbernen Teller mit Reichsadler und Widmung.
Dass von Papen vom Papst und von Mussolini empfangen wurde und aus den Händen des Kardinalstaatssekretärs den höchsten Orden erhielt, den der Vatikan an ungekrönte Häupter zu vergeben hat, hatte gute Gründe. Von dem damaligen Vizekanzler des Deutschen Reiches, der im Januar 1933 Adolf Hitler zur Reichskanzlerschaft verholfen hatte und seitdem eine Koalitionsregierung mit ihm bildete, war die Initiative zu dieser Vereinbarung ausgegangen - einem Staatskirchenvertrag, der die katholischen Angelegenheiten im Reich regeln sollte.
Noch bevor von Papen anschließend von Papst Pius XI. zu einer zwanzigminütigen Privataudienz empfangen wurde, meldete er in einem Telegramm Vollzug an Reichskanzler Hitler: "Dank Ihrer großzügigen und weisen staatsmännischen Auffassung", schwadronierte der Vizekanzler, "ist damit ein Werk vollendet, das späterhin als eine historische Tat des Nationalsozialismus anerkannt werden wird." Am Abend stattete von Papen auch dem italienischen Regierungschef Benito Mussolini einen Besuch ab - im Gepäck wiederum feinstes Meißener Porzellan, diesmal allerdings eine Büste Friedrichs des Großen als Geschenk für den "Duce".
NS-Staat und Kirche rasch einig
Die neue Reichsregierung hatte einen außenpolitischen Erfolg angestrebt und deshalb Anfang April 1933 verkündet, ein sogenanntes Reichskonkordat mit dem Heiligen Stuhl abschließen zu wollen. An Ostern hatte von Papen zusammen mit Göring den Vatikan besucht und war in eine erste Verhandlungsrunde eingetreten.
Der Heilige Stuhl ergriff die Chance. Bereits während der Weimarer Republik hatte die katholische Kirche eine Vereinbarung, die das Verhältnis von Staat und Kirche regelt, angestrebt, nachdem frühere Verträge mit dem Deutschen Reich durch die Novemberrevolution und Abschaffung der Monarchie ihre Gültigkeit verloren hatten. Die katholische Kirche wollte damit zugleich der bereits vollzogenen Gleichschaltung aller gesellschaftlichen Akteure im "Dritten Reich" und damit dem Schicksal von Parteien, Gewerkschaften, Presse und Vereinen entgehen.
Während sich Konkordatsverhandlungen üblicherweise über Jahre erstreckten, waren Kirche und NS-Staat in diesem Fall innerhalb weniger Wochen handelseinig geworden: Hitler akzeptierte den vom Vatikan vorgelegten Vertragsentwurf in fast allen Punkten, so dass die entscheidenden Verhandlungen Anfang Juli 1933 in wenigen Tagen abgeschlossen werden konnten.
Zwei Gewinner
Beide Seiten sahen sich als Gewinner der Vereinbarung: Hitler durfte sich im Glanz eines historischen außenpolitischen Erfolgs sonnen. Denn das letzte Reichskonkordat war vor fast 500 Jahren im Jahr 1448 zwischen Kaiser Friedrich III. und Papst Nikolaus V. geschlossen worden. Der Heilige Stuhl betrachtete sich als Sieger des Abkommens, weil die katholische Kirche im Deutschen Reich mit ihren 40 Millionen Gläubigen in immerhin 21 der 34 Artikel bestimmte Rechte zugesichert bekam. Die Einigung zwischen Papst und Führer bot am Abend des 20. Juli 1933 Anlass für zahlreiche Dankgottesdienste im ganzen Land.
Die Übereinkunft sollte ein Mindestmaß an autonomem kirchlichen Leben im Deutschen Reich garantieren. katholische Bekenntnisschulen waren vor der Zerschlagung durch den NS-Staat vertraglich geschützt.
Hitlers wichtigste Forderung aber war ein Verbot der politischen Betätigung katholischer Geistlicher. Der Vatikan stimmte dem zu, und in Artikel 32 des Konkordats hieß es später vielsagend: "Auf Grund der in Deutschland bestehenden besonderen Verhältnisse […] erläßt der Heilige Stuhl Bestimmungen, die für die Geistlichen und Ordensleute die Mitgliedschaft in politischen Parteien und die Tätigkeit für solche Parteien ausschließen."
Neu eingesetzte Bischöfe im Reich mussten fortan bei ihrem Amtsantritt einen Eid auf den NS-Staat leisten: "Vor Gott und auf die heiligen Evangelien schwöre und verspreche ich, so wie es einem Bischof geziemt, dem Deutschen Reich und dem Lande Treue. Ich schwöre und verspreche, die verfassungsmäßig gebildete Regierung zu achten und von meinem Klerus achten zu lassen."
Die NSDAP-Zeitung "Völkischer Beobachter" sah in dem Abkommen deshalb einen echten Durchbruch, denn: "In Zukunft dürfen also Kanzeln und Beichtstühle nicht mehr gegen den nationalsozialistischen Staat mißbraucht werden, sondern Diener der Kirche in Deutschland haben die Pflicht, sich wie jeder Staatsbürger für diesen Staat und seine Grundlage einzusetzen." Zuvor hatte das NS-Blatt den Prestigeerfolg mit der Schlagzeile "Anerkennung des jungen Reiches durch die zweitausendjährige Macht der Kirche" gefeiert.
Die Vatikan-Zeitung "Osservatore Romano" allerdings dementierte, dass mit dem Konkordat eine "Anerkennung einer bestimmten politischen Richtung" verbunden sei. Der Satz durfte in der deutschen Presse nicht zitiert werden.
"Sogar mit dem Teufel"
Hitler hatte es geschickt verstanden, dem katholischen Widerstand gegen seine Terrorherrschaft jegliche Legitimation zu nehmen. Dabei war der Vatikan zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bereits gut über die beginnende Entrechtung der Juden im Deutschen Reich informiert. Im April 1933 hatte die vom Judentum konvertierte katholische Ordensschwester Edith Stein (1891-1942) den Papst in einem Brief auf das Unrecht aufmerksam gemacht und ihn eindringlich vor Kompromissen mit der nationalsozialistischen Regierung gewarnt: "Alles was geschehen ist und noch täglich geschieht, geht von einer Regierung aus, die sich 'christlich' nennt. Seit Wochen warten und hoffen nicht nur die Juden, sondern Tausende treuer Katholiken in Deutschland - und ich denke, in der ganzen Welt - darauf, dass die Kirche Christi ihre Stimme erhebe, um diesem Mißbrauch des Namens Christi Einhalt zu tun."
Auch im katholischen Klerus war der Staatsvertrag nicht unumstritten. Während der Münchner Kardinal Faulhaber den "staatsmännischen Weitblick" Hitlers pries, meinte der Kölner Erzbischof Schulte: "Mit einer Diktatur kann man kein Konkordat schließen."
Doch der Vatikan zeigte solche Berührungsängste nicht. 1929 hatte man sich bereits mit der italienischen Regierung des "Duce" Benito Mussolini auf ein solches Abkommen verständigt. In den zwanziger Jahren versuchte der Heilige Stuhl auch eine Übereinkunft mit der Sowjetunion zu erreichen, um ein Mindestmaß katholischen Lebens in der kommunistischen Diktatur zu sichern.
Den Kritikern des mit Mussolini geschlossenen Lateranvertrags hielt Papst Pius XI. (1922-1939) im Mai 1929 entgegen: "Wenn es sich darum handeln würde, auch nur eine einzige Seele zu retten [...], so würden wir den Mut aufbringen, sogar mit dem Teufel in Person zu verhandeln."
Hitler erbost
In der heutigen historischen Beurteilung des Reichskonkordats von 1933 stehen sich zwei Lager gegenüber: Historiker wie der 2005 verstorbene Amerikaner Gordon A. Craig sahen darin eine "Politik der Anpassung" des Vatikans an das "Dritte Reich", um den Bestand katholischer Einrichtungen zu sichern. Der kirchennahe deutsche Historiker Konrad Repgen hingegen interpretierte das Abkommen ganz entgegengesetzt, nämlich als "vertragsrechtliche Form der Nichtanpassung der katholischen Kirche an das 'Dritte Reich'".
Doch Hitler sollte sich nie an alle Bestimmungen des Konkordats halten. Er nahm seine Zugeständnisse an die katholische Kirche nach und nach zurück, wenngleich das Abkommen formell in Kraft blieb.
Vier Jahre nach dessen Unterzeichnung sah sich Papst Pius XI. in seiner Enzyklika "Mit brennender Sorge" veranlasst, die fortgesetzten Verletzungen des Staatsvertrags öffentlich zu verurteilen und Vertragstreue einzufordern.
Hitler war so erbost über die heimliche Verbreitung dieser Enzyklika im Deutschen Reich, dass er die Aufkündigung des Konkordats in Betracht zog. Gleiches hatte der Vatikan bereits zuvor erwogen, doch das Abkommen sollte das Ende des Zweiten Weltkriegs und der NS-Diktatur überleben. 1957 entschied das Bundesverfassungsgericht, das Konkordat sei nach wie vor gültig. Es gilt bis bis zum heutigen Tag. >





